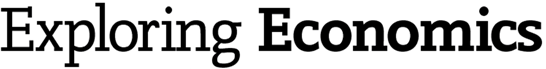Schrauben mit dem Hammer einschlagen - Die VWL und ihr Methodenrepertoire
Netzwerk Plurale Ökonomik


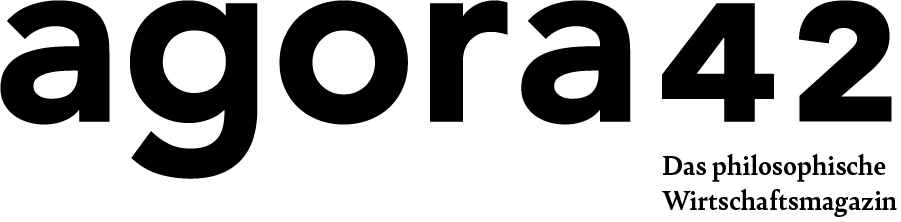
Dieser Artikel wurde auf Agora42 erstveröffentlicht.
In der Kolumne Jenseits von Angebot und Nachfrage nehmen Autor*innen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik die fachlichen Scheuklappen der Lehrbuchökonomie ab und werfen einen pluralökonomischen Blick auf gesellschaftspolitische Fragestellungen.
Das Studium der Volkswirtschaftslehre bietet einen Einblick in den Maschinenraum derjenigen Wissenschaft, welche eigentlich die Funktionsweise unserer Wirtschaft untersuchen sollte. Leider bleibt es jedoch dabei: Die Student*in lernt wenig darüber, wie das Wirtschaften als komplexes Zusammenspiel verschiedener Beteiligter tatsächlich funktioniert oder funktionieren könnte. Das ist der traurige Zustand an deutschen volkswirtschaftlichen Fakultäten. Das Fach arbeitet sich noch immer an Paradigmen ab, die aus den Tiefen seiner Entstehungsgeschichte stammen und sich zum Leidwesen von Regierungen, Unternehmer*innen und Haushalten als grundlegend falsch erwiesen haben. Die Idee des rationalen Individuums bildet noch immer einen der Kerne der ökonomischen Grundausbildung. Dass Personen sich kühl kalkulierend für einen bestimmten Job, Partner*in, Zulieferer oder Lebensweg entscheiden, scheint immer mehr ein grundlegend verzerrtes, anstelle eines vereinfachenden Bildes der Realität zu sein. Mehr noch, auf Grundlage ihrer selbstgewählten Beschränkung auf quantitative Methoden ist es Volkswirt*innen nicht möglich, die komplexen Entscheidungsprozesse von Personen und Organisationen zu erfassen und nachzuzeichnen. Nach der letzten Finanzkrise 2008 saß der Schock tief, doch an den Fakultäten hat sich kaum etwas getan. Es ist erschreckend, überraschend ist es jedoch nicht. Schon nach der großen Depression in den 1930er Jahren rieben sich Volkswirt*innen verwundert die Augen. Trotzdem waren sie nicht imstande die Theorien, welche sie in die Irre geführt hatten, über Bord zu werfen. Wie kann das sein?
Die Schraube und der Hammer
Auf den ersten Blick scheint es der Volkswirtschaftslehre im Vergleich zu anderen Sozialwissenschaften recht gut zu gehen. Ihre Fakultäten stehen in der inneruniversitären Hackordnung weit oben, das Fach ist nach wie vor beliebtes Ziel von Studienanfänger*innen, Forscher*innen werben fleißig Drittmittel ein und Politiker*innen lassen sich gerne von Ökonom*innen beraten. Was die Volkswirtschaftslehre von anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen unterscheidet, sind ihre wissenschaftlichen Methoden. Als einzige Disziplin, welche das menschliche Wirken auf Erden erforscht, verweigert sie sich den sogenannten qualitativen Methoden.
Der qualitative Methodenkasten wird in der volkswirtschaftlichen Ausbildung elegant wegignoriert. Dementsprechend findet er auch in der Forschung kaum Anwendung. Viele Volkswirt*innen haben falsche Vorstellungen von qualitativen Methoden. Manche denken gar, es würde sich um Methoden handeln, die eine hohe Qualität haben. Das klingt lustig, ist aber zugleich traurig. Die Verweigerung gegenüber dieser Art von Methoden geht soweit, dass viele Volkswirt*innen nicht imstande sind ihre Ablehnung gegenüber der Methodik argumentativ zu artikulieren. Aus Unwissenheit wird behauptet, die Methodik sei nicht wissenschaftlich und entsprechende Forschungsergebnisse werden nicht ernst genommen, geschweige denn veröffentlicht. Gerne wird auch behauptet, die Ökonomik arbeite nun mal mit quantitativen Methoden, sollen sich doch die anderen mit qualitativem Forschungswerkzeug beschäftigen. Auch das ist lustig: Das Forschungswerkzeug der Ökonom*in ist der Statistik-Hammer und wenn das Forschungsproblem im Gewand einer Schraube daherkommt, dann muss sie eben ein wenig härter zuschlagen. Aber was ist nun qualitative Methodik und warum sollte sich die Volkswirtschaftslehre damit befassen?
Der Plausch der Erkenntnis
Der Ökonom Michael Piore hat zu dieser Frage einen erhellenden Artikel veröffentlicht. Als Student hat er sich in seiner Abschlussarbeit mit der Frage befasst, welchen Effekt Automatisierung auf den Ausbildungsstand von Fabrikarbeiter*innen hat. Dazu wollte Piore statistische Daten aus zwei Fabriken miteinander vergleichen. Um an die Daten zu gelangen, musste er Gespräche mit Angestellten der Fabriken führen. Die hatten nicht immer Lust und Zeit sich ausführlich mit ihm auseinanderzusetzen. Um das Vertrauen seiner Gesprächspartner*innen zu gewinnen, hat Piore zunächst versucht, die Fabrikarbeiter*innen in ein kurzes, unverfängliches Gespräch zu verwickeln. Der Student merkte, dass viele Angestellte die einleitenden Fragen nutzten um ihm zu erklären, wie das aus ihrer Perspektive eigentlich alles so abläuft, bei ihnen in der Fabrik. Wenn er bald darauf drängte, die eigentlich in seinem Fragebogen notierten Themen abzuarbeiten, verflachten die Gespräche. Die Angestellten gaben kaum noch Informationen preis oder machten gar Falschangaben, um kritischen Nachfragen zu entgehen.
Die im Kaffeeklatschmodus erzählten Geschichten passten nicht mit seiner anfänglichen Theorie zusammen, mit welcher er die Problematik untersuchen wollte. Der Zusammenhang vom Ausbildungsstand der Arbeiter*innen und der eingesetzten Technologie in der Fabrik schien ein völlig anderer zu sein, als es sich der Student Piore und sein*e Professor*in im Vorhinein ausgemalt hatten. Piore entschied sich dazu, die Aspekte aus den Geschichten der Angestellten mit der ursprünglichen Theorie zu vergleichen, um diese anzupassen. Damit bewegte sich Piore außerhalb des Erlaubten einer gewöhnlichen ökonomischen Abschlussarbeit. Er muss eine Menge Mut und eine sehr progressive Professor*in gehabt haben. Denn eigentlich lautete die Aufgabenstellung nach statistisch relevanten Informationen zu der Theorie zu fahnden, die von Anfang an falsch war.
Unvoreingenommen in die Welt gehen
Die zwei Herangehensweisen sind gar nicht so verschieden, denn das Ziel ist das gleiche. Ökonom*innen sind auf der Suche nach Theorien, welche die Gesetzmäßigkeiten des Wirtschaftslebens bestmöglich beschreiben sollen. Der qualitative Weg gibt vor, möglichst unvoreingenommen in die Welt da draußen zu gehen und sich die Sache mal genau anzugucken. Aber systematisch! Das heißt oftmals zusammen mit vielen Menschen, die sich mit dem Thema auskennen oder davon betroffen sind, lange und intensive Gespräche zu führen, diese Gespräche dann systematisch auszuwerten und aus den sich ergebenden Mustern eine Theorie zu formulieren. Es kann auch bedeuten, Menschen in ihrem Verhalten zu beobachten oder Diskurse und Narrative unter die Lupe zu nehmen. Der quantitative Weg besagt zu prüfen, ob die Richtigkeit einer vorher aufgestellten Theorie mit einer relevanten Menge an Daten bestätigt werden kann. Die aufmerksame Leser*in könnte nun denken: Heureka – die beiden Wege ergänzen sich ja wunderbar! Stimmt. Zumindest sehen das die meisten Sozialwissenschaftler*innen heutzutage so. Das Prinzip nennt sich auf neudeutsch mixed methods und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Methoden für neue Ideen
Wenn aber prinzipiell beide Wege zum Ziel führen können, warum ist es so gefährlich nur einen, und im Fall der Ökonomik jenen der quantitativen Methodik, zu beschreiten? Die Statistik ist dazu geeignet, eine bestehende Theorie zu prüfen. Sie ist leider nicht dafür geschaffen, neue Theorien zu entwickeln. Die neoklassischen Theorien der zeitgenössischen Ökonomik gehen zurück auf die Klassiker der Disziplin aus dem 18. Jahrhundert. Sie wurden unzählige Male widerlegt. Es wurden jedoch kaum neue entwickelt. Ein gängiges Narrativ von neoklassischen Ökonom*innen ist, dass die bestehenden Theorien bekanntermaßen nicht besonders gut seien, es aber leider keine besseren gebe. Kein Wunder: Volkswirt*innen fehlt das Werkzeug zur Entwicklung neuer Theorien! Sie beherrschen die Techniken, um das Bruttoinlandsprodukt zu berechnen und ökonomische Theorien zu falsifizieren, aber es fehlt ihnen an Möglichkeiten, um auf wissenschaftlichem Wege auf neue Ideen zu kommen.
Zudem stimmt es nicht, dass es keine Alternativen zu den verstaubten ökonomischen Theorien gibt. Jedoch stammen sie aus Nachbardisziplinen, welche sich ganz selbstverständlich qualitativer Methoden bedienen. Die stark mit der Ökonomik in Verbindung stehende Idee des rationalen Individuums hat nach dem zweiten Weltkrieg die Sozialwissenschaften inspiriert. Doch die Theorie ist überholt und die Zeiten, in denen sich andere Disziplinen an Ideen aus der Ökonomik bedienen, sind vorbei. In neuen zukunftsträchtigen Forschungsfeldern wie den Nachhaltigkeitswissenschaften spielt Ökonomik auf theoretischer Ebene eine untergeordnete oder keine Rolle. Vertreter*innen des Fachs sehen das naturgemäß anders, leider sind sie mit dieser Position zunehmend alleine. Wenn die Ökonomik ihre intellektuelle Verarmung aufhalten, ihren theoretischen Kanon erneuern und nicht zu einem technischen Fach der angewandten Statistik reduziert werden möchte, muss sie sich vermehrt den qualitativen Methoden öffnen.

Zum Autor:
Jörn Schirok hat im Bachelor VWL an der FU Berlin und im Master Wirtschafts- und Sozialgeographie an der Universität Osnabrück studiert. Er war als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Bioverfahrenstechnik an der Fachhochschule Osnabrück tätig. Zurzeit studiert er Raumplanung mit einem Schwerpunkt auf Geoinformationssysteme in Lissabon.
Vom Autor empfohlen:
| SACH-FACHBUCH | ROMAN | FILME | ||
|---|---|---|---|---|
|
Lea Molina Caminero & Jörn Schirok: Woman on the move in South Africa – Development, Migration and Gender from a Translocal Perspective, Konferenz-Poster für die 16. efas-Fachtagung: Frauen global: Perspektiven der feministischen Ökonomie an der HTW-Berlin (2018). |
Jack London: Lockruf des Goldes (zuerst 1910) |
Igby Goes Down von Burr Steers (2002) |