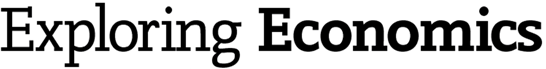Inklusion ist eine radikale Idee
Economist for Future, 2021
Inklusion ist eine radikale Idee
Clara Porak
Erstveröffentlichung im Makronom
Inklusion ist ein Konzept, das unser Wirtschaftssystem existenziell in Frage stellt. Bei konsequenter Anwendung würden wir uns von der Vormachtstellung der Erwerbsarbeit verabschieden. Ein Beitrag von Clara Porak.



![]()
Was folgt aus der Klimakrise für unsere Wirtschaft(sweisen) und das Denken darüber? Im Angesicht der Fridays-for-Future-Proteste hat sich aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik eine neue Initiative herausgebildet: Economists for Future. Mit der gleichnamigen Debattenreihe werden zentrale Fragen einer zukunftsfähigen Wirtschaft in den Fokus gerückt. Im Zentrum stehen nicht nur kritische Auseinandersetzungen mit dem Status Quo der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch mögliche Wege und angemessene Antworten auf die dringlichen Herausforderungen und Notwendigkeiten. Dabei werden verschiedene Orientierungspunkte für einen tiefgreifenden Strukturwandel diskutiert.
Behinderung ist unser Ordnungsmodell für Leistung. Behindert / Nicht-Behindert, das sind die Kategorien, anhand derer wir ganz fundamental festlegen, ob jemand leistungsfähig ist. Mit Leistung ist in dem Fall vor allem die Fähigkeit zur Erwerbsarbeit gemeint. Das ist allein schon inhaltlich falsch, doch das Prinzip hält sich recht hartnäckig. Ich werde deshalb im Folgenden argumentieren, dass Inklusion unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem radikal zum Besseren verändern würde.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen haben ein Recht auf Teilhabe. Wenn es ihnen verwehrt wird, dann ist das System ein Problem, weil es nicht zu allen Menschen passt – und nicht eine Person das Problem, weil sie nicht ins System passt. Das gilt für alle Menschen, nicht nur für jene, die marginalisiert sind. Dieses Prinzip anzuwenden, würde zu einer grundlegenden Transformation führen.
Um das nachvollziehen zu können ist es zunächst wichtig zu begreifen, worin aktuell das Problem der mangelnden Teilhabe von Menschen mit Behinderungen besteht und wie groß es immer noch ist. Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderung ist laut Arbeitsmarktservice in Österreich 2019 wesentlich höher als die von nichtbehinderten Menschen. Je schwerer die Behinderung, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Person erwerbstätig ist. Viele Menschen mit Behinderung verbringen so den Großteil ihrer Zeit in Sondereinrichtungen und haben wenige Freiheiten und Berührungspunkte mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft. Sie haben so kaum Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, sich zu überlegen, wer sie sein und was sie tun wollen und wenig Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.
Diese Nachteile ergeben sich nicht daraus, dass Menschen mit Behinderung „schwach” wären oder eine Behinderung traurig und krank macht. Das Problem sind die Einschränkungen unserer Gesellschaft. Das ist es, was Inklusion meint: dass sich Systeme ändern müssen und nicht Menschen.
Es gibt noch so viel zu entdecken!
Im Entdecken Bereich haben wir hunderte Materialen z. B. Videos, Texte und Podcasts zu ökonomischen Themen gesammelt. Außerdem kannst du selber Material vorschlagen!
Warum Inklusion ein revolutionäres Konzept ist
An dieser Stelle halte ich es für zentral, meine Position transparent zu machen: Ich habe keine Behinderung. Das bedeutet, dass ich nicht für die Community sprechen kann. Ich bin auch keine Ökonomin, sondern Journalistin, Aktivistin für Klimagerechtigkeit und studiere aktuell Internationale Entwicklung in Wien. Meine Perspektive auf die Ökonomie kann und soll also als Außenperspektive gesehen werden. Ich schreibe diesen Beitrag vor allem als Mitorganisatorin des inklusiven Projektes „andererseits”. Allerdings kann ich aus der Perspektive derjenigen über Inklusion sprechen, deren strukturelle Privilegien das Problem sind: die Menschen ohne Behinderungen.
Unsere Idee von „normal” verunmöglicht vielen Menschen mit Behinderung eine Normalität
Das Problem sind unsere gesellschaftlichen Strukturen, die Menschen aufgrund einer Behinderung ausschließen. Das Problem sind wir, die Menschen ohne Behinderungen. Unsere Idee von „normal” verunmöglicht vielen Menschen mit Behinderung eine Normalität. Menschen mit Behinderungen haben das Recht, freie Entscheidungen zu treffen, wie alle anderen Menschen auch. Sie verdienen Begegnungen auf Augenhöhe.
Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Obwohl etwa zwanzig Prozent der Menschen eine Behinderung haben, sehen wir sie kaum in den Medien, auf der Straße, in der Schule. Menschen mit Behinderungen, ihre Rechte und Interessen, werden von unserem System unsichtbar gemacht oder es wird überhaupt kein Raum für sie freigeräumt. Niemand ist gegen Inklusion. Niemand hat etwas gegen Menschen mit Behinderung. Alle loben das Engagement für diese Gruppe. Aber niemand interessiert sich dafür. Auch das muss sich ändern. Auch Menschen ohne Behinderungen müssen für die Rechte von Menschen mit Behinderungen kämpfen.
Darum eben ist Inklusion ein revolutionäres Konzept. Inklusion zu Ende zu denken bedeutet nicht nur die Leben von Menschen mit Behinderungen zum Besseren zu verändern, sondern unser aller Leben. Es geht um unseren Arbeitsmarkt, unsere Schule, eigentlich alles neu zu denken und einzusehen: Wir Menschen sind richtig, wie wir sind. Nur eben auf unterschiedliche Art und Weise.
Das Projekt andererseits
Unser Projekt andererseits möchte zeigen, wie das funktionieren kann. andererseits ist eine Initiative für Inklusion im Journalismus. Wir sind ein Team von etwa 25 jungen Journalist:innen mit und ohne Behinderungen, die gemeinsam an journalistischen Beiträgen arbeiten. Denn auch Journalismus braucht Vielfalt: Je unterschiedlicher die Menschen sind, die Journalismus machen, desto interessanter und realitätsnäher ist das Ergebnis.
Doch mit andererseits wollen wir mehr, als eine Nische zu schaffen, in dem wir den eigentlich Ausgeschlossen ermöglichen mitzumachen. Wir wollen einen Rahmen schaffen, der niemanden ausschließt. Das ist ein ambitioniertes Ziel, an dem wir stetig arbeiten. Etwa die Hälfte unserer Redakteur:innen hat eine Behinderung. Wir arbeiten und entscheiden nicht nur gemeinsam, sondern bauen Prozesse um die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Teammitglieder. Auf unserer Website erscheinen wöchentlich Beiträge – von Interviews, hin zu Essays, oder Reportagen; alle zwei Wochen kommt unser Podcast „Sag’s einfach!” heraus; alle drei bis vier Monate erscheint ein Recherche-Schwerpunkt zu verschiedenen Themen. Bei uns zählen unterschiedliche Perspektiven. Unsere Leser:innen schätzen das. Sie sind jung und engagiert, wir erreichen sie auf digitalen Kanälen, über unseren Newsletter, sowie auf Social Media.
Unser Grundsatz: Wir sind softcore. Das heißt, dass wir Gefühle in den Vordergrund stellen. Denn in unserem Verständnis sind Gefühle politisch. Dabei ist uns klar: Die Gefühle aller Menschen sind gleich viel wert. Doch die Erlebnisse, Emotionsfelder und Perspektiven von marginalisierten Gruppen haben weniger Platz in der öffentlichen Debatte. Genau diese Menschen zeigen aber am besten, wo unsere Gesellschaft noch an sich arbeiten muss, um fair und gerecht zu sein. Die Superkraft ihrer Perspektive bereichert alle, da sie sensibilisiert und auf neue Art und Weise von der Welt erzählt. Wir möchten damit zeigen, dass Diversität und Inklusion keine Buzzwörter sind, sondern Modelle, nach denen man nachhaltig wirksame Strukturen bauen kann.
Das soziale Modell von Behinderung
Um das zu verstehen ist es wichtig, das soziale Modell von Behinderung zu kennen. Unser Sozialhilfesystem sowie unser gesellschaftlicher Diskurs wird noch immer stark von dem medizinischen Modell von Behinderung dominiert: Demnach geht es darum, einem Menschen, der zum Beispiel nicht gehen kann, zu helfen, seinen Mangel möglichst gut auszugleichen.
Wenn wir uns von dem Konzept Behinderung verabschieden, wird es schwer, Leistung von Nicht-Leistung abzugrenzen
Seit mehreren Jahrzehnten versucht die Disability-Rights-Bewegung deutlich zu machen: Das stimmt so nicht. Sie stellen das soziale Modell von Behinderung vor. Es besagt, dass nicht der Mensch das Problem ist, sondern die Gesellschaft. Ein Mensch ist nicht behindert, sondern er wird behindert, von unserer Gesellschaft und von einem System, das nicht auf seine Bedürfnisse ausgelegt ist. Wenn wir eine Gesellschaft schaffen, die auf möglichst alle Bedürfnisse Rücksicht nimmt, gibt es keine Behinderung mehr.
Davon ausgehend wird auch klarer, was ich mit Inklusion als revolutionäres Konzept meine. Denn wenn wir uns von dem Konzept Behinderung verabschieden, wird es schwer, Leistung von Nicht-Leistung abzugrenzen. Wir können Menschen nicht länger in Erwerbstätige, in Leistungsträger und davon abhängige einteilen. Ein inklusives Wirtschaftssystem kann nicht auf Leistung, Wettbewerb und Wachstum ausgerichtet sein, weil es keinen Sinn ergibt. Damit sind auch Fragen intersektionaler Diskriminierung mitgedacht, wie zum Beispiel Klasse oder Geschlecht. Das hätte Konsequenzen für alle Bereiche unserer Gesellschaft, für alle Standbeine, auf denen das System beruht.
Bevor wir uns ganz von der Idee der Leistung verabschieden würden, würden wir vielleicht beginnen, sie an anderen Orten zu suchen. Das verweist auf feministische und postkoloniale Diskurse um Erwerbs- und Care-Arbeit. Denn Inklusion umzusetzen, würde Care-Arbeit als Ort der Wertschöpfung aufwerten. Menschen mit Behinderungen leisten oft viel Care-Arbeit. Das ist auch dann der Fall, wenn sie einen zu hohen Unterstützungsbedarf haben, um produktive Erwerbsarbeit zu leisten. Inklusion könnte also in einem ersten Schritt Care ins Zentrum des Wirtschaftssystems rücken.
Inklusion und eine auf maximale Produktivität ausgelegte Wirtschaft gehen einfach nicht zusammen
Damit würden wir uns von der Vormachtstellung der Erwerbsarbeit verabschieden. Aktuell ist Erwerbsarbeit ein zentraler Moment der Partizipation in unserer Gesellschaft. Wer nicht arbeitet, fällt aus vielen sozialen Systemen. Auch deshalb begegnen Menschen ohne Behinderung so selten Menschen mit Behinderung: Sie sind aus der Erwerbsarbeit und damit auch aus vielen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen. Davon ausgehend stellen sich noch größere Fragen: Wenn wir Leistung nicht mehr bezahlen, warum bezahlen wir dann Menschen für ihre Arbeit? Was würde Arbeit ohne Leistung eigentlich bedeuten? Warum gibt es dann überhaupt noch Geld? Wer entscheidet wer, wieviel bekommt? Die Antwort auf diese Fragen müsste dann heißen: Jede:r bekommt, was er:sie braucht.
Inklusion würde also den Weg dafür ebnen, dass wir der Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft weniger Raum geben, dass Arbeit statt Leistung bezahlt wird, dass wir über ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, dass Subsistenz als Menschenrecht ernst genommen wird, dass Care Arbeit endlich den Raum in unserem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem bekommt, den sie in der Erwerbswelt ohnehin schon hat.
Inklusion und Wachstum
Aber mehr noch: Wir müssten uns auch vom Wachstumsparadigma verabschieden. Inklusion und eine auf maximale Produktivität ausgelegte Wirtschaft gehen einfach nicht zusammen. Zweifel ist ein grundlegender Moment der Inklusion, denn Inklusion ist auch Zweifel: Die Denkfigur ist die ständige Problematisierung dessen, was wir für Leistung, für Arbeit, für Normalität halten. Diese ständige Problematisierung bedeutet Unordnung, Zweifel, Chaos. Das ist nicht wirtschaftlich produktiv, aber notwendig. Wir werden uns immer wieder fragen müssen: Ist es das, was wir wollen? Und wenn ja warum wollen wir das? Wen oder was schließt das dann aus? Wie wird ausgeschlossen? Geht es auch anders?
Das gilt auch für das Wirtschaftssystem. Wir würden uns wieder und wieder fragen müssen, was wir eigentlich von unserem Wirtschaftssystem brauchen, was wir wollen. Durch diese wiederkehrende Reflexion ergäbe sich eine Heterotrophie, viele Lösungen, die widersprüchlich und unterschiedlich sein können. Vielleicht würde das Wirtschaften an der einen oder anderen Stelle überraschend ähnlich aussehen, wie es das gerade tut. Und in einer anderen Situation, in einem anderen Prozess, radikal anders. Das halte ich nicht für ein Problem, sondern für eine Notwendigkeit. Bei Inklusion geht es immer auch um Zweifel. Es geht darum, sich die Möglichkeit zu geben, der Vielfalt wirklich Raum einnehmen zu lassen. Das bedeutet zwangsläufig, dass es nicht die eine Lösung geben kann und dass sich diese Lösungen durchaus auch widersprechen können. Eine geordnete Welt ohne Zweifel ist in einem inklusiven System nicht mehr möglich. Wir werden lernen müssen, Unordnung zu ertragen. Wir werden lernen müssen, Zweifel zu lieben und Widersprüche zu ertragen.
Eben deshalb ist Inklusion ein radikales Konzept, das unser Wirtschaftssystem existenziell in Frage stellt. Natürlich sind mit Inklusion nicht alle Probleme gelöst, vor allem weil wir sie als Prozess verstehen, nicht als Ziel, aber Projekte wie andererseits weiter zu denken, bedeutet ein menschenfreundlicheres System zu schaffen. Darum ist Inklusion jeden Versuch wert.
Zur Autorin:
Clara Porak ist Journalistin und Aktivistin in Wien. Sie ist Teil des Projektes andererseits, dass sich für Inklusion im Journalismus einsetzt, Klimaaktivistin bei Extinction Rebellion und FridaysforFuture und recherchiert vor allem zu Klima- und sozialer Gerechtigkeit, Feminismus und Inklusion.