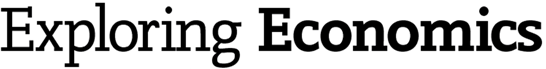„Der Markt“ und seine Politische Ökonomie
Working Paper Serie der Cusanus Hochschule, 2015
Exploring Economics Working Paper Selection
Wir sammeln und veröffentlichen ausgewählte Working Paper und Zeitschriftenartikel auf Exploring Economics.
„Der Markt“ und seine Politische Ökonomie
Ordoliberale und ‚Österreichische’ Konzepte
Walter Ötsch und Stephan Pühringer
Abstract: Obwohl der Begriff „der Markt“ (in der Einzahl) andauernd – sowohl in der Theorie als auch in Alltagsdiskurse – mit einer großen Selbstverständlichkeit verwendet wird, hat er eine Geschichte, die fast 100 Jahre zurückgeht. Diese Begrifflichkeit wurde erstmals in der Österreichischen Schule der Nationalökonomie, und zwar von Ludwig Mises und Friedrich Hayek, und von Ordoliberalen wie Walter Eucken oder Wilhelm Röpke entwickelt. Ihr gemeinsamer Hintergrund war die Sichtweise eines bedrohten Liberalismus und die Vision einer neuen Gesellschaft. Diesem Ziel hatten ihre ökonomischen Theorien zu dienen. Sie stellen – obwohl dies oft verneint wird – eine genuine Politische Ökonomie dar.
JEL codes: B 25, B29, B31, B41, B53
Key words: Marktfundamentalismus, Liberalismus, Neoliberalismus, Markt, Marktdiskurs, Marktideologie, Mises, Hayek, Euken, Röpke, Müller-Armack, Ordnung
1. Der historische Ausgangspunkt: die Krise des Liberalismus
Der ökonomischen Theorien „des Marktes“ entstehen in den Zwanziger und Dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie liefern eine spezifische Antwort auf die Krise des Liberalismus, die damals evident geworden war. Der Liberalismus als politisches und ökonomisches Konzept hat bekanntlich eine lange Geschichte. Er entstand (nach vielen Vorarbeiten) im 17. und 18. Jahrhundert und setzte sich vor allem in Großbritannien und den Niederlanden, später dann in Frankreich und in den USA sowohl theoretisch als auch praktisch (Politik gestaltend) durch. Anfang des 19. Jahrhunderts war die „Philosophie der Freiheit“ eine aktive Bewegung in fast allen Ländern Europas. Ihr Ziel war es, den Freiraum der Gesellschaft zu erweitern und traditionelle absolutistische und autoritäre Vorstellungen von Staat und Gesellschaft zurückzudrängen.
Diese große Bewegung geriet in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von vielen Seiten unter Beschuss. Sozialreformer und Kapitalismuskritiker thematisierten das soziale Elend im Gefolge der „Industriellen Revolution“, die ausgehend von Großbritannien andere Länder erfasste. Im neuen Deutschen Reich schuf Bismarck, auch als Antwort auf sozialistische Strömungen, die Grundlage für einen Wohlfahrtsstaat, durchaus als antiliberales Programm. Gleichzeitig wandten sich nationalistische und imperialistische Strömungen aggressiv gegen die globale Perspektive im klassischen Liberalismus, die z. B. im Postulat eines „freien“ Handels enthalten ist. Der Nationalismus der Großmächte führte zu einem Wettrüstenund schließlich zum Ersten Weltkrieg, sein Ausgang veränderte die politische Ordnung in Europa. Zeitgleich etablierten sich viele neue antiliberale Bewegungen: in Russland ein „Realer Sozialismus“, in Europa zahlreiche nationalistische Bewegungen, wie der Faschismus und der Nationalsozialismus. Diese Konstellation wurde durch die Weltwirtschaftskrise verschärft, die damals auch als Krise der klassisch-liberalen Wirtschaftspolitik gedeutet wurde. In dieser Hinsicht bezeichnen die zwanziger und dreißiger Jahre des Zwanzigsten Jahrhunderts einen historischen Tiefpunkt der klassisch-liberalen Bewegung.
Aus dieser Situation entstanden zwei „Erneuerungsbewegungen“ der liberalen Idee: zum einen der Ansatz von Keynes, der als Teil des liberalen Establishments von Großbritannien (und seines Empires) ein Wirtschaftssystem, das in eine tiefe Krise geraten war, von innen her reformieren wollte.1 Die zweite Bewegung stellte der Marktfundamentalismus dar, damit bezeichnen wir die Theorien „des Marktes“. Er entstand im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts und präsentierte eine andere Antwort auf die Krise des Liberalismus. Er deutete den Gang der Geschichte negativ und sah „die Zivilisation“ insgesamt als bedroht an. Ein derartiges Geschichtsbild wurde zeitgleich von den deutschen Ordoliberalen und von der Österreichischen Schule der Nationalökonomie vertreten, letztere verkörpert in Ludwig von Mises (1881-1973) und Friedrich August von Hayek (1899-1992), sie gelten als Vertreter der dritten und vierten Generation der Österreichischen Schule (Quaas/Quaas 2013). Beide schlugen apokalyptische Töne an (ähnlich auch die Ordoliberalen, siehe unten). Durch „den Sozialismus“, so meinten sie, sei „die Zivilisation“ bedroht.
Mises konstatierte in den zwanziger Jahren ein „Zeitalter des Sozialismus.“ (Mises 1922, 1), u. a. verkörpert in den Austromarxisten und im ‚Wiener Kreis’ (Nordmann 2005, 75ff.). Später wurde auch Keynes als „Sozialist“ bezeichnet. Der „Sozialismus“ selbst war nach Mises „nicht Wegbereiter einer besseren und schöneren Zukunft, sondern Zertrümmerer dessen, was Jahrtausende der Kultur mühsam geschaffen haben.“ (Mises 1932, 424) Hayek entwarf ähnliche Szenarien. Für ihn ging es um nicht weniger als „den Fortbestand unserer Zivilisation“ (Hayek 1996, 153):
„Die Auseinandersetzung zwischen Marktordnung und Sozialismus ist nicht weniger als eine Überlebensfrage. Sozialistischen Moralvorstellungen zu folgen, hieße einen großen Teil der heutigen Menschheit zu vernichten und einen großen Teil der übrigen verarmen zu lassen.“ (ebenda, 4)
Die Geschichtsphilosophie von Mises und Hayek stellte einen Bruch mit der alten liberalen Ansicht dar (die bei Smith, Malthus und Ricardo in unterschiedlichen Versionen zu finden sind), es gäbe historische Gesetzmäßigkeiten, die den Gang der gesellschaftlichen Entwicklung erklären könnten. Auch die Idee eines „Fortschritts“, die bei Smith konstitutiv war (z. B. in seiner Theorie der Entwicklung der Gesellschaft über vier Stadien), wurde von ihnen als überholter Geschichtsdeterminismus verworfen. In der Geschichte selbst, so meinten sie, gäbe es keinen Automatismus, der einen Gang „der Geschichte“ in eine bestimmte Richtung lenken könnte.2 (vgl. auch Thomasberger 2011 und 2012, 29ff.)3
Die positive (theoretische) Antwort zum Gang der Geschichte fiel bei Mises und Hayek unterschiedlich aus, die praktische Folgerung war aber die gleiche: Man müsse (angesichts einer drohenden Katastrophe) danach trachten, die Gesellschaft aktiv zu beeinflussen. Beide gingen dabei vom Postulat des Bewusstseins bzw. des Denkens aus. Hier lag nach ihrer Ansicht der Schlüssel für eine Veränderung der Gesellschaft. Diese werde in ihrer längerfristigen Entwicklung nicht durch objektive Tatbestände, sondern durch Ideen geformt. Um es mit Marx zu sagen: Nicht das ‚Sein’ bestimmt das‚Bewusstsein’, sondern das ‚Bewusstsein’ das ‚Sein’ (vgl. Thomasberger 2012, 57ff.):
„Die Gesellschaft ist das Erzeugnis menschlichen Handelns. Menschliches Handeln wird von den Ideologien bestimmt. Mithin ist Gesellschaft ein Produkt der Ideologie, und nicht die Ideologie ein Produkt der Gesellschaft.“ (Mises 1940, 166)
Hayek teilte diese Überzeugung. Die großen Ideen, die in einem sehr langfristigen Prozess die Gesellschaft steuern, werden – so meinte er - von einer besonderen Klasse von „Intellektuellen“ entworfen, die er Original Thinkers nennt.4
Auch die Ordoliberalen gingen in ihrer Systembetrachtung stets von Ideen aus. „Ordo“ ist die politisch gesetzte (und politisch zu setzende) Rahmenordnung der Wirtschaft. Die entscheidenden Elemente sind ideeller Art: Recht, Sitte, Moral, Normen, Werte. Der Adressat ist die Politik, gefordert wird eine wert- und normenorientierte Politik.
1 Keynes’ Systemkritik war vor allem moralischer, nicht genuin politischer Natur, z. B. in: “A short view of Russia” (1925), in: Keynes (1987, IX: 268). In einem Brief an Harrod schrieb Keynes am 4. Juli 1938: „(…) gegen Robbins: Die Ökonomik ist wesentlich eine Moralwissenschaft und nicht eine Naturwissenschaft. Das bedeutet, sie verwendet Introspektion und Werturteile.“ (Keynes 1987, XIV: 297). Zur Zusammenfassung der moralischen Kritik von Keynes vgl. Backhouse/Bateman (2009, 645ff.).
2 „Theorie vom menschlichen Handeln und Geschichte stehen in unüberbrückbaren logischen Gegensatz. Die Theorie kann nur apriorisch sein; die Geschichte kann sich immer nur des individualisierenden Verfahrens bedienen und kann niemals aus ihrem Erfahrungsmaterial empirische Gesetze gewinnen. (…) Die Versuche, historische Gesetze aufzustellen, sind so vollkommen gescheitert, dass es nicht lohnt, sich mit ihnen näher zu befassen.“ (Mises 1940, 48f.) Alfred Müller-Armack kritisierte bereits 1932 in Entwicklungsgesetze des Kapitalismus den Geschichtsdeterminismus, ähnlich argumentierte auch Eucken (1952, 204ff.).
3 Mises lehnt auch explizit den Marxschen Geschichtsdeterminismus ab (Mises 1980, 33); zu Eucken vgl. den Überblick bei Runge (1971, 37ff.).
4 „it is their judgment which mainly determines the views on which society will act in the not too distant future. It is no exaggeration to say that, once the more active part of the intellectuals has been converted into a set of beliefs, the process by which these become generally accepted is almost automatic and irresistible. These intellectuals are the organs which modern society has developed for spreading knowledge and ideas, and it is their convictions and opinions which operate as the sieve through which all new conceptions must pass before they can reach the masses.“ (Hayek 1960, 374)
Es gibt noch so viel zu entdecken!
Im Entdecken-Bereich haben wir hunderte Videos, Texte und Podcasts zu ökonomischen Themen gesammelt. Außerdem kannst du selber Material vorschlagen!
„Der Markt“ bei Mises
Die Begrifflichkeit von „dem Markt“ erscheint heute als eine Selbstverständlichkeit, die sowohl in den Medien und in der Politik als auch in vielen Wirtschaftstheorien verwendet wird. Als Kategorie von Wirtschaftstheorien hat „der Markt“ wie jede Kategorie seine Geschichte. Bei Adam Smith ist (im Gegensatz zu vielen Behauptungen) kein Konzept „des Marktes“ zu finden. Ein Markt bezeichnet bei Smith den konkreten Ort von Tauschvorgängen, auch historisch gesehen, und ebenso ist Markt auch der allgemeine Ort für Käufe und Verkäufe.1 Aber „der Markt“ als allgemeine Bezeichnung für die Wirtschaft existiert bei Smith nicht, schon gar nicht in Kontrast zu „der“ Politik. Auch im 19. Jahrhundert ist der marktfundamentale Begriff „der Markt“ nicht zu finden, auch nicht bei den ersten Neoklassikern. Demgegenüber wurde der Begriff „der Markt“ erstmals bei Mises und Hayek und bei den Ordoliberalen als zentrale Kategorie gesetzt; seine heutige Popularität zeigt, wie selbstverständlich marktfundamentale Denkweisen geworden sind. „Der Markt“ wird bei den Österreichern und den Ordoliberalen ohne weitere Begründung sowohl als Tatsache als auch als zentrales Ordnungsprinzip hingestellt und als Kernbegriff in ihren Theorien verwendet.
Ein gutes Beispiel dafür ist Mises. „Der Markt“ stellt für ihn den Kern der Wirtschaft dar:
„Der Mechanismus des Marktes gibt der kapitalistischen Wirtschaft ihren Sinn.“ (Mises 1931, 10)
„Der Markt“ ist im Denken von Mises derart dominant, dass er als Vorlage für die Einteilungen in Wirtschaftsordnungen dient, denn diese werden in Bezug auf ihn definiert. Nach Mises gibt es prinzipiell nur zwei Arten von Wirtschaftssystemen: „den unbehinderten“ und „den behinderten Markt“. „Behinderungen“ kommen durch „Eingriffe“ in „den Markt“ zustande. „Eingriffe“ sind „Befehle“. Sie gehen „von einer gesellschaftlichen Gewalt aus“ und
„zwingen (…) die Eigentümer der Produktionsmittel und die Unternehmer (…) die Produktionsmittel anders zu verwenden, als sie es sonst tun würden.“ (Mises 1929, 6)
„Eingriffe“ haben schädliche Wirkungen, weil sie das System der „freien“ Preisbildung (das in Einklang mit dem „Wesen“ des Menschen steht) „stören“. „Eingriffe“ haben andere Preise zur Folge, „als der Markt sie bilden würde“ (Mises 1940, 229). Jeder „Eingriff“ der „Obrigkeit“ birgt für Mises ein prinzipielles Problem, das dynamisch gesehen werden muss. Schon ein einziger preisrelevanter „Befehl“ stört „das Spiel des Marktes“ und setzt einen Dominoeffekt in gang: „dem ersten Schritt“ müssen „weitere folgen“. Neue Preis-„Befehle“ müssen erlassen werden, am Schluss sind „alle Systeme der Produktion“ direkt der „Obrigkeit“ unterworfen (Mises 1929, 11f.). Mit anderen Worten: nach Mises muss auf diese Weise das Wirtschaftssystem – empirischen Beispielen zum trotz - in Richtung „Sozialismus“ kippen.
Damit reduziert sich der (unendliche) Denkraum möglicher Ordnungen der Wirtschaft auf zwei (dichotome) Alternativen:
„Es gibt eben keine andere Wahl als die: entweder von isolierten Eingriffen in das Spiel des Marktes abzusehen oder aber die gesamte Leitung der Produktion und der Verteilung an die Obrigkeit übertragen. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus; ein Mittelding gibt es eben nicht.“ (ebenda, 12)2
Das Markt-Konzept von Mises zeigt eine weitere Besonderheit, die wir in vielen marktfundamentalen Texten finden. Sie wurde bislang in der Literatur nicht thematisiert und ist nach unserem Verständnis für die politökonomische Stoßrichtung des Marktfundamentalimsus von zentraler Bedeutung. „Der Markt“ wird nämlich in seiner reinen (bei Mises „unbehinderten“) Form einem logischen Gegenteil („dem behinderten Markt“) gegenübergestellt. Die eine Möglichkeit ist das logische Gegenteil der anderen. Wir können letztere als „Nicht-Markt“ bezeichnen (Ötsch 2009 und 2014). „Markt“ und „Nicht-Markt“ füllen den ganzen Raum aller denkbaren Alternativen aus. Jeder der beiden Teile stellt die Negation des anderen dar und führt eine Eigenexistenz - getrennt von seinem Gegenteil.
Das Konzept von „Markt“ und „Nicht-Markt“ ist für das marktfundamentale Denken konstitutiv und durchzieht marktfundamentale Texte. Die behauptete Wahl von Ordnungen ist damit nur als Entweder- Oder-Entscheidung möglich und entpuppt sich so als Schein-Wahl, bei der es nichts zu entscheiden gibt; genau diese Anordnung finden wir auch bei Hayek und bei den Ordoliberalen. Dabei werden die beiden Systeme als in sich homogen hingestellt. Eine historische oder institutionelle Untersuchung vergangener, gegenwärtiger oder zukünftig möglicher Ordnungen entfällt. Man kann letztlich auf sie verzichten, weil alles, was die Wirtschaft ausmacht (und ausmachen kann), als Ausdruck eines dualen Bildes gedeutet wird. Damit wird „Nationalökonomie“ zu einer im Kern geschichtslosen Wissenschaft (auch die Ordoliberalen führen einen Kampf gegen die nach dem Ersten Weltkrieg immer noch dominante Historische Schule)3 und „Markt“ und „Marktwirtschaft“ wird zu einem zeitlosen Konzept (das analog auch in neoklassischen Ansätzen zu finden ist).
Das duale Bild der Wirtschaftsordnungen bei Mises enthält gleichzeitig starke Wertungen, formuliert in einer binären Sprache; ein solcher Sprachgebrauch zeichnet viele marktfundamentale Texte aus. Weil „der Markt“ als „frei“ gilt und sein logisches Gegenteil (der „Nicht-Markt“) durch „Zwang“ charakterisiert wird, bringt die Gegenüberstellung von „Markt“ und „Nicht-Markt“ auch den dualen Gegensatz von Freiheit und Zwang mit sich: Mises (1940, 648) spricht vom „Dualismus von Markt und Obrigkeit“. Dieser Dualismus beschreibt für viele Marktfundamentale bis heute den grundlegenden Antagonismus in der Gesellschaft.4 Dabei wird „Zwang“ dem Staat zugeordnet, während vom „Markt“ ex definitione kein Zwang ausgehen kann. Folgerichtig verneint Mises Machtbildung durch Unternehmen, die Macht in der Wirtschaft liege nur beim Konsumenten (Mises 1932, 433ff.; 1940, 273ff.).
„Liberalismus“ wird bei Mises konsequent mit positiven Begriffen belegt, der „Sozialismus“ mit negativen. Der „Liberalismus“ stehe nach Mises im „Dienst der Verbraucher“, er beschütze die „Arbeitswilligen“. Der „Sozialismus“ hingegen, der sich in allen Formen von „Intervention“ manifestiert, basiere auf „Gewalt“ und „Befehl“. Er diene den „Interessen der Obrigkeit“ und mache „den Gehorsam zur Triebfeder des Handelns.“ (Mises 1929, 6). In diese Klassifikation fallen auch die Gewerkschaften:
„Diese Selbstregulierung des Marktes wird nun durch das Eingreifen der Gewerkschaften, die unter dem Schutze und unter der Beihilfe der Staatsgewalt ihre Wirksamkeit entfalten, empfindlich gestört. (…) Zur Erreichung ihrer Ziele bedienen sich die Gewerkschaften der Gewalt.“ (Mises 1929, 17)
Das marktfundamentale duale Denken mündet in letzter Konsequenz in einem manichäistischen5 Freund- Feind-Diskurs. Die Freunde des „Liberalismus“ wollen nach Mises „die Bejahung des Lebens und Mehrung der Lebensenergien“ (ebenda, 96). Wer aber den „behinderten Markt“ verteidigt, will „die Allmacht des Staates“ und eine „Politik, die alle irdischen Dinge durch Gebote und Verbote der Obrigkeit zu ordnen bestrebt ist“ (ebenda, 124). Freund und Feind sind klar verortet, die politische Botschaft liegt auf der Hand: Es gelten
„alle Eingriffe in das Spiel des Marktes als überflüssig, unnütz oder schädlich.“ (ebenda, 123)
Damit finden alle Probleme der Wirtschaft eine endgültige Erklärung: Sie sind die Folge von „Eingriffen“ in das mit „der Natur“ des Menschen übereinstimmende System „des Marktes“. Mises’ Katallatik geht davon aus,
„dass das Marktgetriebe nicht behindert wird durch weitere institutionelle Gegebenheiten, ihr Markt ist in dem Sinne ein freier Markt, als die Preisbildung nicht gestört wird durch das Walten von Kräften, die für das Getriebe nicht notwendig sind.“ (Mises 1940, 229)
In diesem Denken ist das Konzept „des Marktes“ eine schillernde Figur mit mehreren Bedeutungen (vgl. Ötsch 2009 und 2014a). Bei Mises ist er zum einen ein „Gedankenbild“ (Mises’ Methode der Praxeologie basiert auf Gedankenbilder, Mises 1940, 227ff.): eine gedankliche Vorstellung, die vor jeder Erfahrung gegeben, d. h. a priori gesetzt wird. „Der Markt“ ist aber auch eine empirisch beobachtbare Wirklichkeit, die „tatsächlich“ existiert. Am „Markt“ herrschen nach Mises „Gesetze“, wie das „Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen“ (Mises 1929, 90) oder das Ertragsgesetz (ebenda, 95ff.), vor allem aber das der Preisbildung.
Diese „Gesetze“ weisen dieselbe zwiespältige Natur auf wie die anderen Kategorien bei Mises: Gesetze sind Apriori-Gedankenbilder6 und zugleich Ausdruck realer „Kräfte“.7 Denn am „Markte (sind) Kräfte wirksam (…), die Preisbewegungen auslösen müssen.“ (Mises 1929, 238). „Der Markt“ (als „realer“ Prozess) operiert zugleich als effiziente Steuerungsinstanz mit autoritärer Befugnis:
„Der Markt weist dem Handeln der Einzelnen die Wege und lenkt es dorthin, wo es den Zwecken seiner Mitbürger am nützlichsten werden kann.“ (Mises 1929, 250f.)
Diese schillernde Begriffsverwendung finden wir bei allen marktfundamentalen Theoretikern.
3. “Der Markt” bei Hayek
3.1 Hayek I: „Der Markt“ als Produkt der kulturellen Evolution
Hayek ist ein Schüler von Mises. Ursprünglich ein Anhänger eines „milden Fabianischen Sozialismus“ (Hayek 1996, 307),1 wurde er erst mit über dreißig Jahren durch die Lektüre von Mises „Die Gemeinwirtschaft“ (1922) zum einem marktfundamentalen Ökonomen.2 Hayek teilte den Marktbegriff von Mises einschließlich der politischen Zielsetzungen, aber nicht seine theoretische Fundierung. Er musste, wie er später formulierte, „langsam“ lernen, dass
„(…) sich mit einigem Nachdenken eine Begründung finden ließ, die er (Mises - Anm. d. V.) nicht ausgesprochen hatte.“3
Im Unterschied zu Mises will Hayek „dem Markt“ ein endgültiges philosophisches Konzept geben.4 Dieses Vorhaben hatte Hayek in mehreren Versuchen unternommen und dabei viele Themenfelder angesprochen.5 Hayek hatte aber keinen geschlossenen Entwurf vorgelegt.6 In seinen verschiedenen Theorien blieb Hayek aber immer einer dualen Denkweise von „Markt“ und „Nicht-Markt“ verhaftet. Ein wichtiges Beispiel ist seine Theorie der kulturellen Evolution. Ihr Bauprinzip folgt strikt der dualen Logik von „Markt“ und „Nicht-Markt“. Hayek fasst dabei den Menschen als „rule-following animal“ (Hayek 1996, 22) auf. Menschliches Handeln wird als regelgeleitet verstanden. Die Entwicklung der Menschheit wird daher als Evolution von Regeln konzipiert. Die „Theorie“, die Hayek hier entwirft, enthält nur zwei Phasen mit zwei Arten einander ausschließenden Regeln, die wieder als logische Gegensätze entworfen werden.7 Ohne Begründung und willkürlich (aber konsequent im dualen Denken) wird die gesamte Menschheitsgeschichte in zwei Phasen eingeteilt: die „frühe Urzeit“ sowie die „entwickelte Ordnung“. Die erste Phase wird historisch vage positioniert: „eher hunderttausende Jahre als fünf- oder sechstausend“, einen Absatz später heißt es „zehn- oder zwanzigtausend Jahre“ (Hayek 1996, 12).8 Der „primitive Mensch“ hätte jedenfalls in einem überschaubaren Verband mit Kontakten „von Angesicht zu Angesicht“ gelebt (Hayek 1979, 11ff.). Hier hätten Menschen (noch) „gemeinsame Ziele und Wahrnehmungen“ gehabt. Ihr sozialer Zusammenhalt sei emotionaler Art und hänge
„(…) entscheidend von Solidaritätsgefühl und Altruismus ab: Gefühle, die man Mitgliedern der eigenen Gruppe entgegenbrachte, nicht aber anderen Menschen.“ (Hayek 1996, 8)
In dieser Phase seien die Menschen nach Hayek von „Instinkten“ (Hayek 1996, 9) und „angeborenen Reaktionen“ (Hayek 1996, 13) geleitet. Hayek braucht den (für menschliches Verhalten kaum brauchbaren) Begriff „Instinkt“ zu einer Gegenüberstellung zu „Vernunft“. Diese dominiere in der zweiten Phase der Menschheitsgeschichte. Hayek nennt das dabei entstandene Regelsystem „erweiterte“, „umfassende“ oder „spontane Ordnung“ bzw. „Zivilisation“. Der Übergang von Phase eins zu Phase zwei käme durch eine „kulturelle Selektion“ von Gruppen zustande,9 der die aber von Individuen realisiert würde, die nach Hayeks eigener Aussage gar nicht in der Lage dazu seien, da sie ja nur mit „Instinkten“ ausgestattet sind. Dabei würden sich jene Gruppen durchsetzen, die Regeln besitzen, „die ihnen ermöglichten, sich erfolgreicher zu vermehren und Gruppenfremde einzubeziehen.“ (Hayek 1996, 12; in gleicher Weise auch in Hayek 1960, 36 und ORF 1983, 21). Diese Entwicklung wird von Hayek als „natürlicher“ Prozess geschildert. Ein „Wettbewerb“ unter Gruppen würde, so Hayek, „die Evolution“ vorantreiben:
„Veränderung, Anpassung und Wettbewerb sind im Grunde dieselbe Art von Vorgang.“ (Hayek 1996, 24) 10
Die „erweiterte Ordnung“ sei – im Vergleich zur „Urhorde“ – nach Hayek ungemein komplexer. Hier koordinieren sich Menschen nicht direkt und persönlich, sondern durch abstrakte Regeln. Grundlegend sind dabei die Regeln der Wirtschaft. Sie werden wie bei Mises direkt mit einem bestimmten Handeln per se in Beziehung gesetzt (eine Verdeutlichung der oben genannten „konstitutiven“ Ideen):
„Hauptverantwortlich für die Entstehung dieser außergewöhnlichen Ordnung und die Existenz der Menschheit in ihrer gegenwärtigen Größe und Aufgliederung sind die Regeln des menschlichen Verhaltens, die sich allmählich herausbildeten (insbesondere diejenigen, die Sondereigentum, Redlichkeit, Vertragsfreiheit, Tausch, Handel, Wettbewerb, Gewinn und Privatsphäre behandeln).“ (Hayek 1996, 8)
Zusammengefasst: Für Hayek ist die Marktordnung eine aus der kulturellen Evolution entstandene abstrakte Ordnung, die als „spontane Ordnung“ gekennzeichnet wird. Das Konzept „des Marktes“ bekommt damit eine neue theoretische Herleitung. „Der Markt“ (als reale Ordnung) erscheint jetzt nicht als historisch kontingente Institution, sondern als das notwendige Produkt einer „natürlichen“ Evolution. Die kulturelle Geschichte der Menschheit entpuppt sich somit als ein (simpel entworfener) Selektionsmechanismus mit dem Kapitalismus als Höhepunkt.11
„Für mich ist der Markt völlig analog zur Sprache, zum Recht, zur Moral. Der Markt ist keine vom menschlichen Verstand geschaffene Tradition, sondern eine, die in einer der Darwinistischen Entwicklung sehr ähnlichen Methode entstanden ist.“ (Hayek in ORF 1983, 21)
Zwar hat die Geschichte der Menschheit viele Entwicklungslinien, aber diese werden von Hayek (ohne kulturgeschichtliche Befunde zu nennen) begründungsfrei zu einem einzigen Narrativ verdichtet. Später nimmt er auch Bezug auf „den Fortschritt“, der sich dabei manifestiert haben soll (Hayek 1979, 35). Hayeks Narrativ „des Marktes“ führt zur Frage, ob das, was als „Nicht-Markt“ angesehen wird, auch Ergebnis „der“ Evolution ist bzw. zugespitzt gefragt: Wie kann man reale und historisch manifeste Ordnungen erklären, die Hayeks „konstitutiven“ Ideen widersprechen? Sind auch „realsozialistische“ Ordnungen und (noch) nicht vollumfänglich marktwirtschaftlich organisierte Staaten Teil „der Zivilisation“, wie Hayek sie beschreibt, oder bleibt die behauptete „Evolution“ nur auf den Kapitalismus westeuropäischer Provenienz beschränkt?
Hayek kann dieses zentrale Problem im Rahmen seines Ansatzes nicht lösen. Denn es enthält den Zirkel: Entweder alle entstandenen Ordnungen sind „natürliche Selektionsergebnisse“. Dann wäre es laut Hayek selbst eine Anmaßung, über diese zu befinden. Oder sie sind auf diese Weise nicht entstanden, dann stimmt seine Theorie nicht.12
Als „Lösung“ für dieses Problem definiert Hayek die Existenz nichtmarktwirtschaftlicher Ordnungen als „(…) Wiederauftauchen unterdrückter ursprünglicher Instinkte“ bzw. „(…) die lange Zeit unterdrückten Urinstinkte (…)“ seien „(…) wieder an die Oberfläche gekommen“ (Hayek 1979, 29). Damit wird der Widerspruch innerhalb seiner eigenwilligen Geschichtsinterpretation zwar nicht gelöst, aber dahin separiert, was Hayek als Marktfundamentaler von Anfang an will: eine maximale Diskreditierung andersartiger Theorien und Personen. Auf sie wird nämlich der fragwürdige „Gegensatz“ von „Instinkt“ und „Vernunft“ projiziert. Hayek argumentiert so: Die gegenwärtigen Menschen würden „gleichzeitig in zwei Welten“ leben, einerseits in einer Familie – dem Abbild der ursprünglichen Horde mit ihrer Solidaritätsethik – und andererseits in der spontanen abstrakten Ordnung, d. h. in einem „Makrokosmos (die Zivilisation im großen)“ (ebenda, 15). Diese Ordnung erfordere aber für ihre Existenz eine andere Moral als jene in der kleinen Gruppe. Vor allem müssten die abstrakten Eigentumsregeln (die „den Markt“ konstituieren) anerkannt werden. Genau das wollen die „Sozialisten“ bzw. „die Linken“ nach Hayek verhindern (ebenda, 25): Diese besäßen nämlich eine „atavistische Sehnsucht nach dem Leben des edlen Wilden“ (Hayek 1996, 15)13 und verträten eine „naive und kindlich animistische Weltsicht“ (ebenda, 48). Kognitiv sind sie in der Frühgeschichte der Menschheit steckengeblieben:
„Intellektuelle können natürlich behaupten, eine neue und bessere „soziale“ Moral erfunden zu haben, die genau das bewerkstelligt, aber diese „neuen“ Regeln stellen einen Rückfall in die Moral der primitiven Mikro-Ordnung vor und können schwerlich Leben und Gesundheit der Milliarden Menschen erhalten, die die Makro-Ordnung nährt.“ (Hayek 1979, 79)
Andersdenkende sind in Hayeks dualem „Kosmos“ also von „angeborenen Instinkten“ beherrscht. Mental und psychologisch agieren sie wie die „Primitiven“ der Vorzeit.14 Gleichzeitig maßen sie sich ein Wissen an (so auch der Titel einer gleichlautenden Publikation von 1973), das ihnen in keiner Weise zusteht. Konsequent muss man ihnen daher den Diskurs verweigern.
3.2 Hayek II: „Der Markt“ als Kommunikations-Mechanismus
Die bekannteste Variante, mit denen Hayek seine Verteidigung des Kapitalismus formuliert hat, ist vermutlich seine Theorie „des Marktes“ als („objektiver“) Mechanismus zur „Entdeckung“ und Verteilung von („subjektivem“) Wissen. Auch hier verwendet Hayek in Kompatibilität zu seinen anderen binären Grundunterscheidungen ein spezifisches duales Konzept. Dieses basiert auf einer psychologischen Theorie des Bewusstseins, die Hayek schon in den zwanziger Jahren entworfen hat, aber erst 1952 als „The Sensory Order“ publiziert wurde (Hayek 1952).1 Die Sensory Order meint eine qualitative Schicht zwischen Mensch und Umwelt: eine Ordnung der phänomenalen Welt, die durch den Geist gebildet wird. Diese „Ordnung“ bildet nach Hayek ein geschlossenes Netzwerk.2 Sie ist dem Menschen nicht bewusst und aus ihr entsprießt sein Bewusstsein und sein Handeln.
In „Economics and Knowledge“ (Hayek 1937) wird gesagt, dass das Subjekt und seine ihm nicht bewussten Prozesse der Verarbeitung von Informationen bzw. der Generierung von Wissen zwar die Basis der Wissensentstehung bilde. Aber diese Prozesse seien für andere nicht beobacht- und kaum nachvollziehbar. (Es macht z.B. nach Hayek keinen Sinn, von den „Präferenzen“ anderer zu reden.)3 Damit wird das Subjekt-Konzept von Mises reformuliert und kann einen größeren Gestaltungsraum in Anspruch nehmen: Für Mises sind Zwecke subjektiver Art, für Hayek Wissen generell. Wie kann aber aus einer radikal subjektiven Wissensbasis eine objektive Regelordnung entstehen?
Hayek steht hier wiederum vor einem Dilemma, welches aber nicht angesprochen wird. Hayek kann den Übergang von der „Subjektivität“ der Akteure zur „Objektivität“ „des Marktes“ nur so vornehmen, indem er entscheidende Sachverhalte nicht thematisiert. Ein wesentliches Glied in dieser Kette ist die Vermengung von Syntax (die Struktur, die Grammatik, die auch in digitalen Medien technisch transportiert werden kann) und Semantik (der Bedeutung) von Zeichen und Sprache.
„Wenn Hayek also sagt: Ausgangspunkt der Ökonomik seien die „auf eine Vielzahl von Menschen verteilten Informationen“ (Hayek 1996, 159); „the dispersion and imperfection of all knowledge are two of the basic facts from which the social sciences have to start’’ (Hayek 2010, 93), so vermengt er schon am Beginn seiner Überlegungen Wissen und Information. Informationen kann man kraft ihrer physischen Träger verteilen; am Wissen kann man nur Anteil haben. Die Kategorien der traditionellen Ökonomik sind partiell auf Informationen, nicht aber auf das Wissen anwendbar. Zu sagen: „Invention is (…) the production of knowledge“,4 ist ebenso ein Kategorienfehler, wie von einer „distribution of knowledge“ (Hayek 1948, 549) zu sprechen (vgl. auch den Buchtitel: „The Production and Distribution of Knowledge“)5. Neue Ideen als Elemente des Wissens werden im kreativen Prozess entdeckt und erlangen nur in einem Bewusstsein Bedeutung (Brodbeck 2013). Ideen sind also keine handelbaren Dinge. Wohl gibt es Märkte für Informationen, nicht aber für Wissensformen. Wer Experten engagiert, kauft nicht deren Wissen, sondern ihre Leistungen.” (Brodbeck 2014, 32)
Nach dem wissensfundierten Markt-Konzept, wie es Hayek konzipiert, sind die individuellen Pläne der Akteure Ausgangspunkt des „Funktionierens“ von „Markt“. Die Subjekte können sich nicht direkt koordinieren, weil das „in“ ihnen enthaltene Wissen größtenteils nicht bewusst ist. Die mangelnde Basis „im“ Bewusstsein des Menschen benötigt für Hayek eine über-menschliche und über-bewusste Instanz, damit eine Koordination im Einklang mit „der“ individuellen Freiheit möglich wird. Dies gewährleistet „der Markt“ mit seinen Preisen. Er ist ein („objektiver“) „Mechanismus zur Nutzung verstreuter Informationen“ (Hayek 1996, 14), indem er verstreutes (subjektives) Wissen koordiniert. „Wettbewerb“ erscheint in diesem Konzept als „Entdeckungsverfahren“ (Hayek 1996, 16):
„We must look at the price system as such a mechanism for communicating information if we want to understand its real function which, of course, it fulfills less perfectly as prices grow more rigid. (…) The most significant fact about this system is the economy of knowledge with which it operates, or how little the individual participants need to know in order to be able to take the right action. In abbreviated form, by a kind of symbol, only the most essential information is passed on and passed on only to those concerned. It is more than a metaphor to describe the price system as a kind of machinery for registering change, or a system of telecommunications which enables individual producers to watch merely the movement of a few pointers, as an engineer might watch the hands of a few dials, in order to adjust their activities to changes of which they may never know more than is reflected in the price movement.” (Hayek 1948, 86f.)6
Damit will Hayek auch jeder Systemplanung (der behaupteten Intention des „Nicht-Marktes“) eine Absage erteilen: subjektives Wissen kann kollektiv nicht gewusst werden - es kann auch nicht in einen Zentralplan überführt werden:
„The ‚data‘ from which the economic calculus starts are never for the whole society ‚given‘ to a single mind.“ (Hayek 1945, 519)
Aber das Argument geht noch weiter. Es bezieht sich nicht nur auf eine „sozialistische“ Wirtschaftsordnung (mit Planwirtschaft), sondern auch auf die „sozialistischen“ Inhalte innerhalb der „erweiterten Ordnung“ – und meint alle Personen, die kritisch denken, d. h. eine Reflexion über das System vornehmen. Genau das will Hayek aber verhindern. Nach ihm sei eine solche Reflexion gar nicht möglich, weil das Wissen, das hier benötigt wird, in einem Subjekt niemals vorhanden sein kann. (Auch hier wieder ein Zirkelschluss: Bezieht man dies auf Hayek selbst, dann dürfte er über die „große Ordnung“ keinerlei Aussagen tätigen. (vgl. Brodbeck 2001).7 Jeder Versuch, das System der Wirtschaft aufgrund einer kritischen System-Reflexion beeinflussen zu wollen, führt nach Hayek zu „Stillstand“ und „Zerstörung“ „unserer Gesellschaft“.8 Um das zu verhindern, ist ein Denkverbot zu verhängen: Wer den Kapitalismus oder wesentliche Züge des Wirtschaftssystems kritisiert, begehe eine „verhängnisvolle Anmaßung“ (Hayek 1996).9
3.3 Hayek III: Der Mensch angesichts „des Marktes“
Hayek revidiert damit die Sichtweise der klassischen Aufklärung, die dem Menschen ein umfassendes Vernunftvermögen zugesprochen hat. Deswegen war er ja berechtigt, das soziale Leben im Widerstand gegen den Absolutismus neu zu organisieren und eine Fülle von sozialen Designs zu entwerfen. Bei Hayek hingegen ist angesichts „des Marktes“ genau das zu untersagen. Denn die Menschen hätten nicht das Wissen, um in die Marktordnung bewusst „eingreifen“ zu können. Hayeks Markt-Personen werden partiell als bewusst- und geistlos aufgefasst, sie sind nur die Knoten im riesigen Netzwerk „des Marktes“:
„The individuals are merely the foci in the network of relationships.” (Hayek 1952, 34)
Nach Hayek sei es der menschlichen Vernunft nicht mehr möglich, über sich selbst angemessen zu reflektieren, weil die Vernunft ihre eigenen Regeln nicht vollständig verstehen kann. Für das menschliche Handeln ist daher nicht das Reflektieren, sondern die Einbettung in einen übergeordneten Mechanismus entscheidend.1 Der Mensch als „Knoten“ agiert rein mechanisch: nicht durch
„(…) bewusste Wahl oder absichtliche Selektion, sondern mittels eines Mechanismus, über den wir nicht bewusste Kontrolle ausüben.“ (Hayek 1986, 49; vgl. auch Brodbeck 2014, 34).2
Hayeks Abwertung der menschlichen Vernunft korrespondiert mit der Aufwertung der „Vernunft“ des „Marktes“. Die „erweiterte Ordnung“, so Hayek, besitze eine Transzendenz und diese beziehe sich
„(…) im buchstäblichen Sinn (…) auf das, was weit über unser Verständnis, unsere Wünsche und Zielvorstellungen sowie unsere Sinneswahrnehmungen hinausgeht, und auf das, was Wissen enthält und schafft, dass kein einzelnes Gehirn und keine einzelne Organisation besitzen und erfinden kann.“ (Hayek 1996, 76)
Die Transzendenz der erweiterten Ordnung (als eine Art Übervernunft) wird damit folgerichtig zu einer Befehlsinstanz: „Unpersönliche Signale“ „sagen“ uns, wie „wir“ uns „zu verhalten“ haben (Hayek 1979, 24ff.). Die richtige Einstellung zum „Markt“ muss also ein „Gehorsam diesen Regeln gegenüber“ sein (ebenda, 25). Wir hätten nach Hayek „die Verpflichtung (…), die Resultate des Marktes auch dann zu akzeptieren, wenn er sich gegen uns wendet.“ (Hayek 1981, 131). An anderer Stelle fordert Hayek „(…) eine Haltung der Demut angesichts dieses sozialen Prozesses (…)“ ein (Hayek 2003, 209). Unterordnung unter „höhere“ soziale Instanzen zu fordern steht einer populären Vorstellung von Freiheit und Individualität entgegen. Folgerichtig muss Hayek auch den Begriff Individualismus dual teilen, er unterscheidet zwischen einem „wahren“ und einem „falschen Individualismus“.3 Der „falsche“ Individualismus steht in der Tradition der französischen Aufklärung. Dieser sei ein „falscher“, das ist ein „rationalistischer“ Individualismus, da er den Menschen als „rational“ verstehe und ihm damit eine Einzelvernunft zuspricht, mit der dieser die Welt erbaue. Da zu dieser auch die menschliche Gesellschaft selbst gehöre, habe der „falsche“ Individualismus auch
„(…) immer die Tendenz, sich zum Gegenteil des Individualismus zu entwickeln, nämlich zum Sozialismus oder Kollektivismus.“ (Hayek 2002, 6)
Der „wahre“ Individualismus hingegen gehe vom Menschen als „(…) ein sehr irrationales und fehlbares Wesen (…)“ aus, wie Hayek hier mit Bezug auf den „englischen“ Individualismus a la Smith und Hume und vor allem Mandelville ausführt (ebenda, 10). Aber Hayek geht über diese Autoren hinaus. Seine „unsichtbare Hand“ besitzt eine über-menschliche „intelligible“ Qualität, die jeden (vernunftmäßig beschränkten) Einzelnen weit überragt. Hayeks „freies“ Subjekt besitzt einen begrenzten Denkhorizont, der vom „Markt“ weit überragt wird. Hayek formuliert diese Differenz in quasi-religiöser Sprache: „Wir“ (als letztlich Unwissende) sollten schlichtweg „dem Markt“ vertrauen4 und an ihn „glauben“ (Hayek 1971, 229). Das alte Vertrauen in die Vorhersehung Gottes (die wir noch bei Adam Smith finden, vgl. Ötsch 2007) wird bei Hayek durch ein Vertrauen in „den Markt“ ersetzt. Folgerichtig wird „der Markt“ in letzter Konsequenz in die Nähe Gottes gerückt.5 Hayeks „Philosophie der Freiheit“ impliziert damit die Unterwerfung der Individuen unter den „Markt“ bzw. die marktwirtschaftlich organisierte Gesellschaft.6 Diese Forderung stellt ein konstitutives Merkmal des Marktfundamentalismus in all seinen Varianten dar. Nach Hayek ist die Menschheit einer monistischen „transzendenten Ordnung“ überantwortet. Welche „Anmaßung“ – um in Hayeks Worten zu verbleiben – ist verhängnisvoller als ein solches Konstrukt?
4. “Der Markt” im Ordoliberlismus
Hayeks Verdikt einer bewussten Gestaltung der Wirtschaft scheint dem Ordoliberalismus diametral zu widersprechen, bei dem die (bewusste) Wahl des Wirtschaftssystems bzw. der Wirtschaftsordnung ein zentrales Thema darstellt. Der Gegensatz in Theorie (und teilweise in Politik) widerspricht nicht den Gemeinsamkeiten auf der grundlegenden Ebene der Kategorie „des Marktes“ (die nach unserer These die gemeinsamen Netzwerke verständlich macht). Der Ordoliberalismus umfasste bekanntlich mehrere Strömungen. Ptak (2004, 17) unterscheidet drei Gruppen (wobei er aber ihre Einheit im Agieren betont):
1. die „Freiburger Schule“ mit Walter Eucken (1891-1950), Franz Böhm (1895-1977) und Leonhard Miksch (1901-1950),
2. den „soziologischen Flügel“ um Alexander Rüstow (1855-1963) und Wilhelm Röpke (1899- 1966), und
3. die Gruppe der Praktiker mit Ludwig Erhard (1897-1977) und dem FAZ-Herausgeber Erich Welter (1900-1982).
(Alfred Müller-Armack (1901-1978) rechnet er der zweiten und der dritten Gruppe zu.)1
Ausgangspunkt des Ordoliberalismus war die eingangs erwähnte Krise des Liberalismus. Die Ordoliberalen sprachen schon ab ihren ersten Texten, die in den Jahren 1932 und 1933 unabhängig voneinander von Eucken, Rüstow, Röpke und Müller-Armack formuliert wurden (für einen Überblick vgl. Ptak 2004, 24) von der „Krisis des Kapitalismus“ (Eucken 1932) bzw. später auch von der „gegenwärtigen Weltkatastrophe“ (Rüstow 2004, 40) und der „Gesellschaftskrisis der Gegenwart“ (so der Titel eines Werkes von Röpke aus 1942). Nach Röpke manifestierte sich die Krise in einem „die Gesellschaftsstruktur zerstörenden Zerbröckelungs- und Verklumpungsprozess“ (Röpke 1979, 23) bzw. in einer „wahre(n) Katastrophe, die zum innersten Wesen unserer heutigen Kulturkrise gehört.“ (ebenda, 99, vgl. Goldschmidt 2009 und Wörsdorfer 2011, 21ff.) Mit anderen Worten: Die zeitgenössische Krise betraf – je nach Autor - nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den Staat, die Gesellschaft oder die Kultur insgesamt.
Auf diese Krise wollte der Ordoliberalismus eine Antwort geben. Ihre Überwindung liege nicht in einer Änderung der (als marktwirtschaftlich bzw. kapitalistisch verstandenen) Wirtschaft als solche, sondern in ihrer „Ordnung“: das sei jener Rahmen der Wirtschaft, in dem ihre konkreten „Prozesse“ ablaufen (Kolev 2010, 4). Daraus begründete sich für die Ordoliberalen ein Primat der „Ordnung“: für eine Analyse des Wirtschaftssystems muss zuerst sein Rahmen thematisiert werden. Für die Ordoliberalen war daher eine Gesamtentscheidung über die grundsätzliche Richtung der Wirtschaftsordnung von zentraler Bedeutung. Die Wirtschaftspolitik habe nämlich vor allem die Aufgabe, die „Formen“ zu gestalten, in denen gewirtschaftet wird. Erst danach könne man über konkrete wirtschaftspolitische Vorschläge diskutieren. Bemerkenswert ist dabei der Unterschied zu Keynes. Keynes ging pragmatisch vor, in dem er konkrete Probleme des bestehenden Systems und die sie fundierenden Theorien diskutierte und Alternativen vorschlug. Eine Theorie von Ordnungen entwickelte er dabei nicht. Ordoliberale ÖkonomInnen hingegen beharrten in ihren Texten darauf, dass zuerst über mögliche Wirtschaftsordnungen zu entscheiden wäre. Dabei sei jene Ordnung auszuwählen, in welcher die beklagten Probleme nicht vorkommen würden.
Um welche „Ordnungen“ geht es dabei? Hier wurde von den Ordoliberalen allem idealtypisch argumentiert.2 Entscheidend ist dabei die duale Aufbereitung möglicher Systeme. Nach Eucken (1965, 79f.) könne man in Analogie zu Mises und Hayek aus der „historischen Untersuchung“ zwei „reine konstitutive Grundformen“ ableiten: die „Verkehrswirtschaft“ und die „zentralgeleitete Wirtschaft“. Auf dieser Basis errichtete Eucken eine umfangreiche Formenlehre (Morphologie). Sie umfasste zwei idealtypischen Marktformen für die zentralgeleitete Wirtschaft (mit Unterformen) und fünf für die Verkehrswirtschaft: vollkommene Konkurrenz, Teiloligopol, Oligopol, Teilmonopol und Monopol, aufgefächert nach möglichen Marktzutritt und Art der Preisefestsetzung (ebenda, 91ff.) Im weiterem wurden dabei drei Geldformen unterschieden. Das Ergebnis sind komplizierte Schemata, z.B. eine Tabelle mit 25 Marktformen bei Eucken (ebenda, 111). Im Endeffekt kam Eucken dann auf „einige tausende mögliche Formen der Verkehrswirtschaft“. Die Gesamtheit der jeweiligen Markt- und Geldformen definiert nach Eucken die „Ordnung“, die den Wirtschaftsprozess umrahmt.
Die Fülle dieser Möglichkeiten wird von Eucken in den „Grundlagen der Nationalökonomie“ zum einen für die Diskussion historischer Phänomene genützt (ebenda, 163ff.). Zum anderen aber wird in vielen Fällen mit nur zwei oder drei Ordnungen argumentiert, z. B. in der Diskussion von Konjunkturverläufen, bei der drei Typen von Wirtschaftsordnungen unterschieden werden. Als Faktum wird hier die Existenz auch von „stabilen“ Verkehrswirtschaften mit Gleichgewichtspreisen behauptet,
„(…) in denen die Marktform vollständige Konkurrenz überwiegt, in denen also der bekannte Regulator der Konkurrenzpreisbildung wirksam ist, und in denen der Bankenapparat nicht zu starker Expansion oder Kontraktion neigt. In solchen Wirtschaftsordnungen ist eine Tendenz wirksam, den Wirtschaftsprozess einem Zustand allgemeinen vollkommenen Gleichgewichts nahezubringen.“ (Eucken 1965, 195)
Wo in der Realität eine solche Wirtschaftsordnung gefunden werden könnte, wird nicht gesagt, - auch das ist ein gemeinsames Merkmal marktfundamentaler Theoretiker. Wieder um zeigt sich auch bei Eucken eine bemerkenswerte Diskrepanz. Er lehnte es zwar ab, die vollständige Konkurrenz a priori zu setzen, meinte aber auch, sie „in den Tatbeständen“ der Wirtschaftsgeschichte „entdeckt“ zu haben (ebenda, 256f.) Auf diese Weise kann z. B. in der Diskussion von „wirtschaftlicher Macht“ die vollständige Konkurrenz (als reale Ordnung) der Zentralverwaltungswirtschaft als „extreme, einander entgegengesetzte Grenzfälle“ gegenübergestellt werden (Eucken 1965, 202). Damit wird ein dualer Raum von Freiheit und Unfreiheit entworfen. Denn in letzterer konzentriere sich „alle Macht in der Zentralstelle, die allein Wirtschaftspläne entwirft“. Das „charakteristische Arbeitsverhältnis“ sei hier „Sklaverei und Hörigkeit“ (ebenda, 198).
In der „vollständigen Konkurrenz“ hingegen
„(…) ist der Einzelne fast entmachtet. (…) Und da jede Machtballung fehlt, besteht keine persönliche wirtschaftliche Abhängigkeit, wohl aber eine Abhängigkeit von einem anonymen Markt. (…) Das Problem der ökonomischen Macht würde (dabei) nur wenig sichtbar sein.“ (ebenda, 202)
Diese duale Welt von Gut und Böse, frei und unfrei, durchzieht das ordoliberale Denken. Das „Gute“ wird dabei in der „Konkurrenzpreisbildung“ verortet. Dies kommt schon in Euckens „Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus“ aus dem Jahre 1932 (Eucken 1932)3 zum Vorschein. Diese Arbeit gilt als wichtigster Grundlagentext für die Entstehung des Ordoliberalismus. Eucken diskutierte hier die Weltwirtschaftskrise aus einer ordnungspolitischen Perspektive. In seiner „Analyse“ ist immer ein „guter Kern“ der Wirtschaft präsent. Er manifestiere sich in den „Kräften des Wettbewerbs“, die als Tatsache gesetzt werden. Diese „Kräfte“ seien nach Eucken in Deutschland aktuell lahmgelegt, und zwar durch die spezifische Politikform des „Wirtschaftsstaates“. Diese sei gekennzeichnet durch einen „punktuellen Interventionismus“, weil
„(…) aus der gesamten deutschen Politik die zentrale, alle ihre Einzelteile – also auch die Wirtschaftspolitik – beherrschende politische Idee, die Kraft und der beherrschende Wille“ (verschwunden ist). (ebenda, 303)
Mit anderen Worten: Eucken (und mit ihm viele andere Ordoliberale) analysieren historische Phänomene vor dem Bild eines idealen „Marktes“, der zugleich als Tatsache als auch als Forderung für die Zukunft gefasst wird. Reale historische Wirtschaftsabläufe erscheinen in dieser Sichtweise nicht nur als das, was sich faktisch präsentiert, sondern auch als das, was eine „Konkurrenzpreisbildung“ idealiter ergeben könnte.4 Die Probleme der Gegenwart stellten damit für die Ordoliberalen keine Phänomene per se dar. Sie wurden als Differenz-Tatbestände zu dem gedeutet, was „der Markt“ (noch) sein könnte. Die reale und historisch gewachsene Gesellschaft erscheint nun im Hinblick auf dieses Idealbild als „entartet“:
„Die Entwicklung der Marktwirtschaft zum Kapitalismus ist (…) eine krankhafte Entartungserscheinung.“ (Rüstow u.a. 2001, 122)
Alles, was in der Wirtschaft problematisch erscheint, kann auf diese Weise einem „falschen“ Wirtschaftskonzept zugeschoben werden. Tiefere und empirisch fundierte Analysen realer Prozesse erübrigen sich damit. Geschichtliche Abläufe werden vor dem Hintergrund eines außer- geschichtlichen Idealbilds gedeutet. Gleichzeitig kann es in dieser Denkweise keinen Tatbestand geben, der das Bild „des guten Marktes“ in Frage stellen könnte könnte. Die Vorsetllung von der Wirtschaft hat sich jeder Empirie entledigt. Wie bei Mises und Hayek bleiben auch bei den Ordoliberalen das Potential „des Marktes“von realen Schwierigkeiten unberührt.
Die Ordoliberalen entfalten damit einen Geschichtsmythos analog zu Mises und Hayek: Der historisch sich etablierte „falsche“ Liberalismus habe es nämlich versäumt, bewusst einen Ordnungsrahmen (durch Politik, Staat, Gesellschaft oder Kultur) zu setzen, in welchem „der Markt“ seine positiven Eigenschaften entfalten konnte. Das Ergebnis waren „entartete“ Systeme, wie ein „Wirtschaftsliberalismus“ (Rüstow), ein „Vulgärliberalismus“ (Rüstow), ein „Paläoliberalismus“ (Rüstow) oder ein „Ökonomismus“ (Röpke) (vgl. Lorch 2013, 24ff.). 5
Damit wird – im Einklang mit Mises und Hayek – eine genuin „politische Ökonomie“ entworfen. Auch die Ordoliberalen waren angetreten, die Gesellschaft zu verändern.
„Vor allem die Anhänger der Freiburger Schule hoben die besondere Verantwortung der Wissenschaft für die Ausgestaltung der Wirtschafts- und Sozialordnung hervor. Die Nationalökonomie war in ihren Auffassungen stets auch eine ‚politische Wissenschaft‘, ja sogar eine ‚geistig-sittliche Macht‘.“ (Nützenadel 2005, 128, mit Verweis auf Hensel 1951, 17)
Dazu forderten die Ordoliberalen eine Grundsatzentscheidung für eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung: gleichsam einen optimalen Rahmen für „den Markt“ in all seiner Potentialität. Dieser Rahmen sollte von einer „Gesamtordnungsidee“ (Müller-Armack 1952, 461) abgeleitet werden, welche – je nach Autor – auch soziologische oder kulturelle bzw. religiöse Bestandteile aufwies. Die „Wahl“ dieser Gesamtkonzeption erfolgt letztlich, allen komplexen Katalogen möglicher Marktformen zum Trotz, in einem dual aufbereiteten Feld. Die Zukunft präsentiert sich damit analog zu Mises und Hayek in antigonaler Form: Eucken (2004, 242) spricht von der „(…) Antithese ‚zentral gelenkte Wirtschaft‘ wider ‚freie Wirtschaft‘ (…)“.6 Es gälte, zwischen zwei Möglichkeiten zu wählen – und zwar aus einer „(…) Einsicht in die (…) strenge Ausschließbarkeit der Alternativen.“ Denn für die Frage
„(…) auf welche Ordnungs- und Antriebskräfte das Wirtschaftsleben im ganzen gegründet werden soll, gibt es keinen ’Mittelweg’ oder ‚Dritten Weg’.“ (ebenda, 242)
Damit war sichergestellt, dass die behauptete Wahl wie bei Mises und Hayek auf der Basis von Entweder-Oder-Behauptungen zu erfolgen hatte: Wieder stand die „freie“ Wirtschaft (der freie Markt) der zentral geplanten Wirtschaft (dem Nicht-Markt) binär gegenüber. Entscheidend war für die Ordoliberalen dabei die Setzung der korrekten Dualität. Anstelle der alten historischen Zweiteilung „Paläoliberalismus“ versus „Zentralwirtschaft“ wurde von ihnen die Dichotomie von „richtiger“ Liberalismus versus „Zentralwirtschaft“ postuliert. Nachdem letztere ohnehin als Alternative ausscheiden musste,7 reduzierte sich ihre „Wahl“ damit auf eine „Entscheidung“ zwischen einem „falschen“ und einem „richtigen“ Konzept „des Marktes“. Röpke bringt das so auf den Punkt:
„Im engeren Bereiche der Wirtschaft bedeutet ein solches Programm Bejahung der Marktwirtschaft, unter gleichzeitiger Ablehnung eines entarteten Liberalismus und des bereits in seiner Grundkonzeption unannehmbaren Kollektivismus.“ (Röpke 1944, 18)
Die behauptete „Wahl“ führt so zu einem „Muss“:
„Beginnen müssen wir mit der rücksichtslosen Einsicht, dass, wer den Kollektivismus nicht will, die Marktwirtschaft wollen muss. Marktwirtschaft aber heißt Freiheit des Marktes, freie Preise und elastische Kosten, heißt Anpassungsfähigkeit, Geschmeidigkeit und Unterwerfung der Produzenten unter die Herrschaft der Nachfrage.“ (Röpke 1944, 74)
Auch bei Eucken liegt ein „Zwang“ vor:
„Die heutige Situation zwingt uns, nach einem neuen, dritten Weg zu suchen und auf die beiden kritisierten Lenkungsmethoden zu verzichten. Dieser dritte Weg ist als ‚Wettbewerbsordnung‘ bezeichnet worden.“ (Eucken 1999, 17)
Die „Lösung“ war ein „dritter Weg“, den Röpke wie auch Eucken nach der „Vorentscheidung“ für eine Marktwirtschaft sahen: 8
„Um so froher sollten wir sein, dass wir nicht vor dieser bangen Wahl zwischen ‚Kapitalismus’ und Kollektivismus stehen, sondern dass es einen ‚dritten Weg’ gibt, der die Nachteile sowohl des ‚Kapitalismus’, als auch des Sozialismus vermeidet. Dieser dritte Weg, der mit vollem Bewusstsein eigentlich erst seit anderthalb Jahrzehnten vertreten wird, befindet sich freilich noch im Stadium des Entwurfes, nicht wenige seiner Probleme sind noch ungelöst, die meisten seiner Einzelheiten noch ausarbeitungsbedürftig.“ (Rüstow 2008, 430)
Die für die Zukunft geforderte „Marktwirtschaft“ war für die Ordoliberalen immer eine ideal konzipierte Wirtschaft.9 Bereits 1932 forderte Müller-Armack im Klartext,
„(…) dass ein objektives Ordnungsgefüge, mit dem der erwünschte Erfolg zu erreichen ist, ‚erfunden’ wird.“ (Müller-Armack 1958, 42)
In einer solchen „Erfindung“ wäre „der Markt“ von einem zu ihm passenden Rahmen umgeben:
„In der Tat waren sich die Anwälte der Marktwirtschaft, sofern sie geistig einigermaßen anspruchsvoll sind, immer darüber im klaren, dass der Bereich des Marktes, des Wettbewerbs, der von Angebot und Nachfrage bewegten Preise und der durch sie gesteuerten Produktion nur als Teil einer höheren und weiteren Gesamtordnung verstanden und verteidigt werden kann, wo es sich um Moral, Recht, natürliche Bedingungen der Existenz und des Glücks, um Staat, Politik und Macht handelt. Die Gesellschaft als Ganzes kann nicht auf dem Gesetz von Angebot und Nachfrage aufgebaut werden.“ (Röpke 1958, 130f., hier zit. nach Lorch 2013, 38ff.)
Vor allem mit Blick auf die Erfahrungen aus der Weltwirtschaftskrise sollte diese Ordnung als ethisch- normative angestrebt werden, weil eine Ordnung „des Marktes“ politische und wirtschaftliche Übermacht verhindere und damit die individuelle Freiheit fördere - siehe hier z. B. Müller-Armack (1990, 71) oder Eucken (1965, 202). Diese Ordnung fördert zum einen
„die Durchsetzung der ökonomischen Sachgesetzlichkeit. […] Ihre andere Seite besteht darin, dass hier gleichzeitig ein soziales und ethisches Ordnungswollen verwirklicht werden soll. Und in dieser Verbindung liegt ihre besondere Stärke.“ (Eucken 2004, 369)
Diese „eingerahmte Verkehrswirtschaft“ – später „soziale Marktwirtschaft“ genannt – wies immer optimale Eigenschaften aus, z. B.:
◦ Sie ist instrumentell-effizient, weil der Preis- und Wettbewerbs-“Mechanismus“ ein funktionierendes Knappheits- und Allokationsinstrument darstellt (Eucken (1960, 8) bzw. weil dies ein „Kontrollapparat“ mit „zwingender Kraft“ ist (Eucken 1960, 70);
◦ Sie sorgt via „Markt“ „für eine bestmöglichste Verteilung der Produktivkräfte“ (Röpke 1965, 57);
◦ Sie resultiert damit quasi-automatisch in eine Gleichschaltung von Eigen- und Gemeininteressen (vgl. zusammenfassend Wörsdorfer 1999, 199ff.)
Die Suche nach einer optimalen künftigen Ordnung entpuppt sich somit (im Gleichklang mit Mises und Hayek) als nutzlose Scheinsuche. Wer „den Markt“ (und seine „Mechanismen“, „Gesetze“ oder „Kräfte“) als Tatsache(n) setzt, braucht nichts mehr zu suchen. Daher ist Hajo Riese zuzustimmen, wenn dieser resümiert:
„(…) dass Eucken nicht vorhatte, eine Theorie der Funktionsweise von Wirtschaftsordnungen zu entwickeln, sondern, dass er seine Ordnungstheorie schuf, um das Fundament der Rechtfertigung der freien Verkehrswirtschaft zu legen.“ (Riese 1972, 36)10
5. Die Polysemie des Marktes
Die bisherigen Ausführungen zeigten, wie mehrdeutig Mises, Hayek und die Ordoliberalen das Konzept von „dem Markt“ verwenden. „Der Markt“ ist ein Polysem: er trägt mehrere Bedeutungen in sich. Das Konzept „des Marktes“ (unter Verwendung eines binären Codes mit einem „Nicht-Markt“) weist bei den erwähnten Autoren auch folgende Besonderheiten auf:
(1) eine Vielfalt von Verwendungsweisen: der Begriff „der Markt“ kann deshalb auch nicht operationalisiert werden,
(2) ein widersprüchlichpielten für die Durchsetzung einer marktfundamentalenDenkweise in Deutschland nach 1945 und der Verdrängung des Keynesianismus ab den 70er-Jahren eine entscheidende Rolle.
(3) Die Bedeutungsfes Konzept einer „Planung für den Markt“ (das mit vielen Arten von Politik kompatibel ist) und
(4) einen zutiefst elitären Standpunkt: sowohl für die Gesellschaft wie für das eigene Selbstverständnis als WissenschaftlerIn.
Diese drei Aspekte sülle des Konzeptes „Markt“ ist ein Kennzeichen des Marktfundamentalismus. Polyseme sind wissenschaftlich meist ein Nachteil, in politischen Diskursen hingegen können sie ein Vorteil sein.
„Der Markt“ wird zumindest in folgenden Bedeutungen verwendet:
(1) als reales Phänomen: „Der Markt“ wird als Instanz, Institution oder Prozess gedacht, welcher (oder welchem) eine faktische Existenz zugeschrieben wird. Hier wird die Gültigkeit von „Kräften“, „Mechanismen“, „Tendenzen“ oder „Gesetze“ unterstellt, die beobachtbare Wirkungen entfalten. Im besonderen Maße geht es dabei um „den Mechanismus“ der Preise.
(2) als Normation: „Der Markt“ wird als Instanz mit „Kräften“ verstanden, denen positive Wirkungen zugesprochen werden. Diese werden also normativ interpretiert. Nur „der Markt“, so wird z. B. gesagt, könne die Akteure der Wirtschaft in richtiger Weise regeln. Das liberale System „des Marktes“ muss demgemäß aus ethisch-normativen Gründen als Vorteil erachtet werden.
(3) als Fiktion: „Der Markt“ steht für eine Konstellation, die sich historisch noch niemals voll realisiert hat. In diese Kategorie fällt auch die erwähnte „antifaktische“ Geschichtsschreibung eines „falschen“ oder gar „entarteten“ Liberalismus.
„Die Verkehrswirtschaft in ihrer reinen Form ist nie probiert worden.“ (Hayek in einem Radiointerview, ORF 1983, 51)
(4) als Potentialität: In dieser (historischen) Fiktionalität drückt „der Markt“ (mit seinen positiven Eigenschaften) auch eine Möglichkeit aus, die immer vorhanden ist, aber durch „Hindernisse“, „Zwänge“ oder „irrige“ Ideen (welche als „dem Markt“ nicht entsprechende „Ordnungen“ verstanden werden und worunter letztlich alle „kollektivistischen“ Ideen fallen) sich nicht realisieren kann, aber realisiert werden könnte. (In dieser Verwendung kann man reale Geschichte fiktional auch als „Behinderung“ seiner Potentialität schreiben.)
(5) als Utopie: Diese Potentialität „des Marktes“ wird auf die Zukunft projiziert und eine Zukunft ausgemalt, in der sie sich voll entfalten kann. In dieser Bedeutung beschreibt „der Markt“ in letzter Konsequenz eine geschichtliche Utopie, einen „Nicht-Ort“ („altgriechisch ou- „nicht-“ und tópos „Ort“). Daher konnte Hayek 1949 das Fehlen einer „liberalen Utopie“ konstatieren (Hayek 1960, 384). 1982 hieß es dann:
„Wir Marktwirtschaftler haben noch eine Utopie anzubieten – der Kommunismus hat keine mehr.“ (ORF 1983, 51)
In dieser Bedeutung liefert der Marktfundamentalismus eine Großutopie, vergleichbar jener der französischen Aufklärung oder des Kommunismus.
Die ambivalente und mehrdeutige Verwendung des Konzept von „dem Markt“ basiert auf der dualen Setzung „Markt“ versus „Nicht-Markt“, die nicht begründbar ist. Sie wird zu Beginn der jeweiligen Analyse schlichtweg gesetzt. Gleichzeitig gibt das Konzept „des Marktes“ in seiner Polysemie keine Auskunft, welche institutionellen Bedingungen vorliegen müssen, damit von einer „auf dem Sondereigentum an den Produktionsmitteln aufgebauten Gesellschaftsordnung“ (Mises), einer „spontanen Ordnung“ (Hayek), dem „Kapitalismus“ (Friedman) oder von der „vollständigen Konkurrenz“ (Eucken) geredet werden kann. „Der Markt“ ist kein Konzept, das hinsichtlich seiner institutionellen Bestandteile festgelegt (operationalisiert) ist: wir wissen nicht, welche konkrete Bedingungen vorliegen müssen, damit sich „der Markt“ real manifestiert.1 Er kann auch (historisch, institutionell, konkret) nicht operationalisiert werden, weil eine konkrete Bestimmung die duale Unterscheidung nach homogenen Bereichen von „Markt“ und seinem logischen Gegenteil aufheben würde. (Genau in dieser Nichtbestimmung können Marktfundamentale ein gemeinsames politisches Anliegen verfolgen.)
Die mangelnde Operationalisierbarkeit „des Marktes“ bedeutet auch, dass marktfundamentale Wirtschaftspolitiken über keine gesicherte Grundlage verfügen. Die Setzung „des Marktes“ kollidiert mit seiner Praxis. Dieser Grundwiderspruch durchzieht alle marktfundamentalenKonzepte (Vgl. Pirker 2004, 145), die ausgehendend von „Behinderungen des Marktes“ eine „Deregulierung“ verlangen:
„Auch die Beseitigung von Regeln ist ein konstruktivistischer Eingriff in das System, dessen Wirkungen nicht prognostiziert werden können. (…) Um beurteilen zu können, welche Regeln für die »Bildung einer spontanen Ordnung erforderlich sind«, benötigt man ein Wissen, über das man – wenigstens Hayek zufolge – gar nicht verfügen kann: Man muss wissen, welche Regeln die
»spontane Ordnung« benötigt. Doch gerade dies setzt die Kenntnis von »Einzelheiten« dieser Ordnung voraus. Welche Regelungen der Wettbewerbspolitik, der Geldpolitik, welche Steuern und in welcher Höhe, welche Gesetze zu Rechtsformen von Unternehmen, welche Strafrechtspolitik usw. sind erforderlich, und welche Regeln sind nur ein »konstruktivistischer« Eingriff in die Spontaneität des Marktes? Man braucht diese Fragen nur stellen, um einzusehen, dass sich Hayek selbst entweder ein Wissen zuspricht, dessen bloße Möglichkeit er zugleich hartnäckig leugnet und dessen Quellen er nicht offenlegt, oder das »erforderliche« Maß an Regulierung ist ein bloßer Leerbegriff. In beiden Fällen ist Hayeks Aussage wissenschaftlich wertlos.“ (Brodbeck 2001, 64f.)
Der theoretische Nachteil einer Nichtoperationalisierung des Grundkonzepts stellt im (üblicherweise nicht reflektierten) Diskurs einen Vorteil dar, weil man je nach Thema oder Situation eine der vielen Bedeutungen in den Vordergrund stellen kann. So können Marktfundamentale z. B. immer dann, wenn Probleme des Kapitalismus thematisiert werden, von der realistischen zu einer fiktiven oder utopischen Bedeutung überwechseln. In diesem Schwenk kann „der Markt“ (als Ausdruck des Kapitalismus) niemals mit realen Problemen belangt werden, wie groß sie auch sein mögen. In Bezug auf die Weltwirtschaftskrise meinte z. B. Müller-Armack:
„Es wurde von der wissenschaftlichen Forschung nachgewiesen, dass die Hauptursachen für das Versagen der liberalen Marktwirtschaft gar nicht so sehr in ihr selbst liegen, als in einer Verzerrung, der sie durch den von außen kommenden Interventionismus seit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts zunehmend unterlag.“ (Müller-Armack 1990, 9)
Mit anderen Worten: das Übel liegt nicht im System, sondern kommt immer von außen; die Parallelen zu Äußerungen zur Finanzkrise ab 2008 sind unübersehbar. So hieß es z. B. 2010 vom Finanzexperten Peter Brandner:
„Die Finanzmärkte sind das Einzige, was in den letzten Jahren einigermaßen funktioniert hat.“ (Gaulhofer 2010)
Die Grundregel in diesen Diskursen lautet: Positive Aspekte der Realität (wie hoher Lebensstandard, schnelle Innovationen oder steigende Lebenserwartung) werden für „den Markt“ reklamiert, negative stereotyp dem „Nicht-Markt“ zugewiesen. Für Hayek können marktwirtschaftliche Systeme deshalb im Prinzip keine „ungelösten Probleme“ besitzen:
„Die größten Übelstände, mit denen wir heute zu tun haben, sind (…) ein Ergebnis der Politik und nicht der Marktwirtschaft“. (ORF 1983, 48)
Im Glauben an „den Markt“ erscheint jede Wirtschaftskrise als Produkt einer „interventionistischen“ Wirtschaftspolitik. Denn man kann nach Hayek
„(…) nicht sagen, dass die Marktwirtschaft die Krisen erzeugt, sondern dass die staatliche Politik die Krisen erzeugt.“ (ebenda, 49)2
6. Planung für "den Markt"
Das marktfundamentale Denken steht damit vor einem grundsätzlichen Paradoxon:1
-
Zum einen wird, wie eingangs gesagt, die gesellschaftliche Entwicklung von Ideen abhängig gemacht.
-
Zugleich werden objektive, von Menschen unabhängige Entwicklungsgesetze für die Geschichte der Gesellschaftabgelehnt.
-
Zum anderen beruft man sich aber auf die Realität „des Marktes“ (in logischem Gegensatz zu dem „Nicht-Markt“) und seine „Gesetze“. (Bei Hayek ist „der Markt“ gar von menschlichen Intentionen und Zielsetzungen unabhängig).
-
Daraus leitet man dann den Schluss ab, „den Markt“ (als Ziel, Norm oder Utopie) durch die Politik herstellen, d. h. gezielt Bedingungen für „den Markt“ errichten zu müssen,
-
die nach eigenem Verständnis von einer zentralen Behörde gar nicht errichtet werden können.
Die Folge ist eine Wirtschaftspolitik, die als „Planung für den Markt“ oder als „Regulierung im Namen von Deregulierung“ oder als „Regelung im Namen zukünftiger Nichtregelung“ charakterisiert – und in seiner Polysemie mit vielen Arten von Politik verbunden werden kann. „Planung für den Markt“ ist dabei zugleich „Planung gegen den Nicht-Markt“:
„’Planung für den Markt’ bringt (…) zum Ausdruck (…) das Bewusstsein, dass alternative gesellschaftliche Ordnungen existieren und dass es darauf ankommt, die bestimmte gesellschaftliche Form Markt gegen Alternativen durchzusetzen. Planung für den Markt ist daher immer gleichbedeutend mit: Planung gegen den Sozialismus, gegen eine ‚gemischte’ Wirtschaft und gegen alles, was darauf zielt, Produktion, Verteilung in anderer Form als über Märkte zu organisieren.“ (Thomasberger 2009, 65)
In diesem Paradoxon kollidiert die intendierte Praxis (einer Planung) mit den Inhalten der Theorie (eines nicht-geplanten oder gar nicht-planbaren Marktes). Sie verlangt von den Theoretikern „des Marktes“ das „richtige“ Wissen (nämlich das „des Marktes“) zu besitzen, - auch im Gegensatz zu PolitikerInnen, vor allem jene, welche eine Planung des „Nicht-Marktes“ anstreben. Damit wird eine diskursive Struktur erzeugt, die mehrere Ausprägungen besitzt:
-
ein elitäres Denken seitens der WissenschaftlerInnen gegenüber den PolitikerInnen, einschließlich der damit verbundenen moralischen Implikationen;
-
eine ambivalente Selbstpositionierung von „machtlos“ bis „ratgebend“ als letztlich außenstehend zur „Praxis“, womit die Nichtthematisierung des eigenen Einflusses auf die „Praxis“ einhergeht;
-
ein evoziertes Negativszenario, dabei u. a. mit dem Rückgriff auf Metaphern z. B. der Medizin: hier werden „Märkte“ z. B. als „Patienten“ gesehen, die es zu heilen gilt;
-
darauf aufgesetzt entsprechende (erforderlich seiende) Macherszenarios, z. B. mittels Metaphern der Felder Sport oder Technik (z. B. „(…) an den Schrauben drehen (…)“ usw.);
-
ein Geschichtstelos, der hinter diesen Auffassungen steht (als „Beugen“vor „Notwendigkeiten“) und mit dem sich wiederum die Überlegenheit der „Wissenschaftler“ (der Ökonomie) gegenüber den „Praktikern“ (der Politik) verbindet.
7. Elite und Masse
Elitäres Denken heißt, sich als „auserwählt“ zu begreifen. Damit wird ein soziales System in der Regel in zwei Teile zerlegt: in Elite und in Nichtelite, oft als „Masse“ bezeichnet (vgl. Hartmann 2004, 8ff.). Wodurch legitimieren sich aber Eliten? „Herkunftseliten“ rechtfertigen sich aus sich selbst, z. B. durch ihre ständische oder klassenbezogene Herkunft. Bei Leistungseliten (und weiter gefasst Werteliten) hingegen begründet sich die elitäre Stellung aus bestimmten Merkmalen, wie Qualifikation, Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft, die anzuerkennen seien. Ab den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Eliten vermehrt als „Funktionseliten“ angesprochen (z. B. Mannheim 1935; Lasswell 1934). Hier wurde zum einen auch die Problematik der „Auslese“ systematisiert (z.B. in Wirtschaftseliten, Politikeliten usw.). Zum anderen wurde über diesen Weg das Selbstverständnis, das es Eliten gibt bzw. braucht, neu begründet. Die neue Begründung bestand dabei in der Verknüpfung des Leistungselitären mit einer funktionalen Vorstellung vonGesellschaft.1
Das marktfundamentale Denken ist aus vielen Gründen mit einem elitären Denken eng verwoben (auch abhängig davon, welche politischen Ideen sich konkret mit ihm verbinden). Wichtige Beispiele sind ein Elitenansatz für die Gesellschaft oder für sich selbst als WissenschaftlerIn. Der Ordoliberalismus z.B. war von der Überzeugung getrieben, man könne sich selbst über wirtschaftliche Einzelinteressen stellen und direkt das Gemeinwohl verfolgen. Röpke wollte dies auch institutionalisieren und schlug dazu eine Nobilitas naturalis des Gemeinsinns vor. Darunter verstand er eine über den Klassen stehende moralische Elite, die als „Zensor“ agieren solle.2 Insgesamt wurde im Ordoliberalismus eine Herkunfts- und Machtelite abgelehnt, eine Leistungs- und Wertelite dagegen positiv betont und dazu eine diesbezügliche Positions- und Funktionselite gefordert (vgl. Wörsdorfer 2011, 275).
Elite und Masse formen ein duales Bild einer Gesellschaft. Bei den Ordoliberalen steht „Masse“ nach Ptak
„(…) als Synonym für eine nicht gebildete, unzivilisierte, an primitiven Urinstinkten orientierte Bevölkerungsmehrheit, die sich und die zivilisierte Welt ins Verderben stürzt, wenn sie nicht durch eine starke, durchsetzungsfähige Elite geführt wird.“ (Ptak 2004, 38f.)
Die Vielen der Masse sind aber ein Problem, wenn sie über Einfluss auf die Gesellschaft verfügen. Für Eucken, Röpke und Rüstow lag das zentrale Problem in der „Vermassung“ der Gesellschaft (Eucken 2004, 18 und Röpke 1979, 23, vgl. dazu auch Zweynert 2007, 10ff., Dathe 2009 und Kolev 2011).3 Für Röpke galt die „Vermassung“ als Ausdruck des „Kollektivismus“, d. h. die „Masse“ will nach ihm generell den „Nicht-Markt“. Aber das sei eine „(…) tödliche Gefahr unser gesamten abendländischen Gesellschaft (…)“ (Röpke 1979, 33). Eucken führte 1932 die Weltwirtschaftskrise auf den Einfluss der „(…) chaotischen Kräfte der Masse (…)“ in Staat und Gesellschaft zurück (Eucken 1932, 15).
Wer den Einfluss der „Masse“ auf die Gesellschaft als Problem ansieht, hat letztlich mit der Demokratie selbst Probleme. Demokratie galt für Rüstow und Röpke als Massendemokratie (vgl. Quaas 2000, 200f.), sie garantiert nicht Freiheit per se. Nach Röpke müsse „die Tyrannei der Masse“ beschränkt werden:
„Wenn der Liberalismus daher die Demokratie fordert, so nur unter der Voraussetzung, dass sie mit Regierungen und Sicherungen ausgestattet wird, die dafür sorgen, dass der Liberalismus nicht von der Demokratie verschlungen wird.“ (Ptak 2004,42, hier Röpke 1962, 123f. zitierend)
Analog hat sich Hayek für eine „Demarchie“ ausgesprochen: eine Art „Expertenparlament“ mit einer „Gesetzgebungskammer“, welche seine „Rule of Law“ auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen soll. Hier sollten respektierte „honoratiores, independent public figures“ vertreten sein, eine Art „Weisenparlamaent“ der „the most successful member of the class”, ohne direkte Abhängigkeit von Parteien. (Hayek 1978, 96f.)4
Dem Massen-Bild der Gesellschaft steht bei vielen marktfundamentalen Theoretikern das Bild einer elitären Gruppe „des Marktes“ gegenüber, die man für sich selbst in Anspruch nimmt. Marktfundamentale denken sich selbst oft als Teil einerElite. Für die Zeit nach 1945 kann dabei der Übergang von einer Herkunfts- und Leistungs- bzw. „Wertelite“ in eine ganz bestimmte Funktionselite beobachtet werden, nämlich zu einer Wissenschaftselite. Bis 1933 war es für die Mehrzahl derÖkonomInnen5 bzw. bis 1945 für einige ÖkonomInnen noch selbstverständlich, sich im „Dienste“ der Gesellschaft wirken zu sehen.6 Aber wer sich im Besitz der „richtigen“ Theorie, nämlich der des „Marktes“, wähnt, muss sich selbst als Elite denken. Als solche braucht sie Formen von Organisation, um auf die Gesellschaft im Sinne einer „Planung für den Markt“ einwirken zu können. Am folgerichtigsten hat dies Hayek gedacht, der auf der Ebene der „Weltgesellschaft“ eine globale „Wissenschaftselite“ der Welt institutionell verzahnt. (Den Beginn hat er 1947 mit der Mont Pélerin Gesellschaft gemacht (Hartwell 1995, . Aus ihr sind unzählige Think Tanks hervorgegangen, am umfangreichsten im Atlas-Netzwerk, das den Aufbau von über 100 Think Tanks begleitet hat und heute über 300 Thin Tank weltweit verbindet.)
8. Eine nicht reflektierte Politische Ökonomie
Mit diesen Aspekten wird in jeder der erwähnten Theorien der Anspruch einer genuin „politischen Ökonomie“ erhoben. Er manifestiert sich auch dahingehend, dass immer eine Vernetzung wissenschaftsintern und mit vielen gesellschaftlichen Teilen angestrebt wird. Man will Gesellschaft nicht „nur“ analysieren, sondern aktiv mitformen; im Deutschland der Nachkriegszeit haben dies die Ordoliberalen bekanntlich mit dem Konzept und der politische Installierung einer „sozialen Marktwirtschaft“ getan.
Aber eine marktfundamentale „Politische Ökonomie“ steht analytisch vor einem nicht auflösbaren Widerspruch: Als „liberales“ Konzept geht jeder Ansatz immer vom Individuum aus. Gruppenbildungen und Gruppenprozesse werden nicht analysiert oder als „kollektivistisch“ abgetan. „Beziehungen“ werden als Beziehungen zwischen Individuen bzw. von (isolierten) Individuen mit „dem Markt“ verstanden. Sozialpsychologischen Faktoren (wie Keynes’ Vorstellung von einem „Herdentrieb“ auf Finanzmärkten) wird keine systematische Rolle für das Erkennen wirtschaftlicher Prozesse zugesprochen.
In der dualen Gegenüberstellung von „Markt“ und „Nicht-Markt“ muss „Gruppe“ letztlich mit „Nicht- Markt“ assoziiert werden. Die selbst ernannte „Elite des Marktes“ kann sich daher schwer selbst als Gruppe denken, sie müsste sich dann selbst Aspekte des „Nicht-Marktes“ zuschreiben. Auf diese Weise verhindert das marktfundamentale Denken eine angemessene Reflexion der eigenen Gruppen- bzw. Netzwerkbildung. Analog zur Geschichte der Wirtschaft (die als Kampf von „Markt“ und „Nicht- Markt“ gedeutet wird) kann auch die Geschichte des eigenen wissenschaftlichen Feldes nicht als sozialer (und historisch kontingenter)7 Prozess verstanden werden.8 Auf der einen Seite führt die Forderung nach einer Umgestaltung der Gesellschaft zu einer aktiven Netzwerkbildung, auf der anderen Seite kann genau dieser Prozess von marktfundamentalenTheoretikern nicht analysiert werden:
„Die gleichgesinnten Ökonomen und Wissenschaftler werden nicht als Interessensgruppe gefasst und thematisiert. (…) Die Beziehungen sind immer (…) Einzelbeziehungen. Die inhaltliche Zusammenarbeit ist auf die Lösung konkreter Probleme im Wissenschaftsbetrieb beschränkt. Das Bild des originellen, individuellen Denkers durchzieht die Selbstdarstellungen (…). Dankadressen und die Aufzählung von Kollegen, von denen man gelernt habe, sind in diesem Kontext die größte Annäherung an den Gruppengedanken.“ (Nordmann 2005, 44)9
Das marktfundamentale Denken kann das eigene Tun nicht als sozialen Prozess reflektieren. Der Ansatz verhindert einen klaren Blick auf die Wichtigkeit von Netzwerkbildungen für die Geschichte der Nationalökonomie, nicht nur in Deutschland. Dies mag mit ein Grund sein, warum dazu erst spät Untersuchungen begannen. Im Folgenden sollen Aspekte der Geschichte der deutschsprachigen Nationalökonomie im Zusammenhang mit dem marktfundamentalenDenken und ihren Netzwerken dargestellt werden. Der Fokus liegt in der ersten Zeit nach 1945, weil hier Weichen gestellt wurden, die immer noch nachwirken. Die Darstellung kann nur bruchstückhaft sein und soll weitere Forschungen anregen.
Literaturverzeichnis
Andrae, Jannis (2012): Ideengeschichtliche Aspekte von unabhängigen Institutionen. Diskussionspapier der Helmut-Schmidt-Universität, Fächergruppe Volkswirtschaftslehre Nr. 128. www.hdl.handle.net/10419/71105 (Zugegriffen am: 23.2.2015).
Backhouse, Roger E./Bateman, Bradley W. (2009): Keynes and Capitalism, History of Political Economy 41 (4), 645-671.
Barry, Norman P. (1979): Hayek’s Social and Economic Philosophy, London and Basingstoke: The Macmillan Press.
Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital – kulturelles Kapital – soziales Kapital. In: Kreckel, Reinhard (Hg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt, Sonderband 2, Göttingen: Schwartz, 183-198.
Bress, Ludwig (1996): Walter Eucken und die Makromorphologie. Der deutsche Weg zwischen Struktur und Evolution. In: Schneider, Jürgen/Harbrecht, Wolfgang (Hg.): Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in Deutschland (1933-1993), Stuttgart: Franz Steiner, 251-282.
Brodbeck, Karl-Heinz (2001): Die fragwürdigen Grundlagen des Neoliberalismus. Wirtschaftsordnung und Markt in Hayeks Theorie der Regelselektion, Zeitschrift für Politik 48, 49-71.
Brodbeck, Karl-Heinz (2014): Ökonomik des Wissens. Zur Wirklichkeit der Bilder in der Ökonomik. In: Hirte, Katrin/Thieme, Sebastian/Ötsch, Walter Otto (Hg.): Wissen! Welches Wissen? Debatten zwischen Wahrheit, Theorien und Glauben in der ökonomischen Theorie, Marburg: Metropolis,17-38.
Bundesarchive Koblenz (2004): Überarbeitetes Findbuch des Nachlasses (1169) von Alexander Rüstow. Koblenz: Bundesarchiv. www.ruestow.org/Findbuchx.htm (Zugegriffen am: 23.02.2015).
Caldwell, Bruce (2004): Hayek's Challenge. An Intellectual Biography of F.A.Hayek, Chicago and London: The University of Chicago Press.
Dathe Uwe (2009): Walter Euckens Weg zum Liberalismus (1918-1934), Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik 09/10.
Demm, Eberhard (1988): Max und Alfred Weber im Verein für Socialpolitik. In: Mommsen, Wolfgang J./Schwentker, Wolfgang (Hg.): Max Weber und seine Zeitgenossen, Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 119-136.
Eucken, Walter (1932): Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus. In: Weltwirtschaftliches Archiv36/2, 297-321.
Eucken, Walter (1965): Die Grundlagen der Nationalökonomie, Berlin, Heidelberg und New York: Springer.
Eucken, Walter (1999): Ordnungspolitik, Münster: LIT.
Eucken, Walter (2004): Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Bern und Tübingen: Francke und Mohr (Siebeck).
Fleetwood, Steve (1995): Hayek’s Political Economy. The Socio-Economics of Order, London: Routledge.
Foucault, Michel (2006): Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouvernementalität II, Frankfurt: Suhrkamp.
Gallas, Alexander (2005): The Three Sources of Anti-Socialism: An Inquiry into the Normative Foundations of F.A. Hayek's Politics. www.eprints.lancs.ac.uk/ 267/2/Microsoft_Word_-_B0C917A9.pdf (Zugegriffen am: 27.09.2014).
Gaulhofer, Karl (2010): Europa an die Leine nehmen. In: Wirtschaft international vom 10.06.2010. www.diepresse.com/home/wirtschaft/international/572750/Europa-an-die-Leine-nehmen (Zugegriffen am: 27.09.2014).
Goldschmidt, Nils (2007): Gibt es eine ordoliberale Entwicklungsidee? Walter Euckens Analyse des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels, Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik 12/3 Freiburg: Walter Eucken Institut.
Grossekettler, Heinz (2003): Walter Eucken, Volkswirtschaftliche Diskussionsbeiträge der westfälischen Wilhelm-Universität, Nr. 347, Münster.
Hartmann, Michael (2004): Elitesoziologie. Eine Einführung, Frankfurt am Main: Campus.
Hartwell, Ronald Marx (1995): A History of the Mont Pelerin Society, Indianapolis: Liberty Fund.
Haselbach, Dieter (1991): Autoritärer Liberalismus und soziale Marktwirtschaft. Gesellschaft und Politik im Ordoliberalismus, Baden-Baden: Nomos.
Hayek, Friedrich August (1937): Economics and Knowledge, Economica 4, 33-54.
Hayek, Friedrich August (1945): The Use of Knowledge in Society, The American Economic Review 35, 519- 530.
Hayek, Friedrich August (1948): Individualism and Economic Order, New York & London: The University of Chicago Press.
Hayek, Friedrich August (1952): The Sensory Order. An Inquiry into the Foundations of Theoretical Psychology, Chicago: University of Chicago Press.
Hayek, Friedrich August (1960): The Intellectuals and Socialism. In: Huszar, George B. de (ed.): The Intellectuals: A Controversial Portrait, Glencoe, Illinois: The Free Press, 371-384.
Hayek, Friedrich August (1971): Die Verfassung der Freiheit, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
Hayek, Friedrich August (1973): Die Anmaßung von Wissen, Ordo, Band 26, 12-21.
Hayek, Friedrich August (1979): Die drei Quellen der menschlichen Werte, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Hayek, Friedrich August (1981): Recht, Gesetzgebung und Freiheit. Band 2: Die Illusion der sozialen Gerechtigkeit, Landsberg am Lech: Moderne Industrie.
Hayek, Friedrich August (1983): Hayek on Hayek. An Autobiographical Dialogue, London: Routledge.
Hayek, Friedrich August (1986): Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Band I. Regeln und Ordnung, Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie,
Hayek, Friedrich August (1996): Die verhängnisvolle Anmaßung: Die Irrtümer des Sozialismus, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Hayek, Friedrich August (2002): Wahrer und falscher Individualismus. In: Gesammelte Schriften in deutscher Sprache. Tübingen: J. C. B. Mohr Siebeck, 3-32.
Hayek, Friedrich August (2003): Der Weg zur Knechtschaft. München: Olzog (im Original 1944: The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press).
Hennecke, Hans Jörg (2000): Friedrich August von Hayek. Die Tradition der Freiheit, Düsseldorf: Wirtschaft und Finanzen.
Hensel, Karl Paul (1951): Politische Wissenschaft und Politik, Ordo, Bd. 4, 3-17.
Herder-Donreich, Philipp (1974): Wirtschaftsordnungen. Pluralistische und dynamische Ordnungspolitik, Berlin: Duncker & Humblot.
Hesse, Jan-Otmar (2006): Der Mensch des Unternehmens und der Produktion. Foucaults Sicht auf den Ordoliberalismus und die 'Soziale Marktwirtschaft', Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 2, www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Hesse-2-2006 (Zugegriffen am: 02.03.2015).
Holl, Christopher (2004): Wahrnehmung, menschliches Handeln und Institutionen. Von Hayeks Institutionenökonomik und deren Weiterentwicklung, Tübingen: Mohr Siebeck.
Huber, Frank (2001): Friedrich Hayeks Philosophie der Ordnung. Eine ontologische, epistemologische und methodologische Untersuchung, Dissertation Universität Berlin.
Hutchison, Terence Wilmot (1992): The Politics and Philosophy of Economics: Marxians, Keynesians and Austrians,New York: Gregg Revivals.
Keynes, John M. (1971-1989): The Collected Writings of John Maynard Keynes, edited by Elizabeth Johnson and Donald E. Moggridge, London: Macmillan.
Kolev, Stefan (2010): F. A. Hayek as an Ordo-Liberal, HWWI Research Paper 5(11), www.hdl.handle.net/10419/48214 (Zugegriffen am: 11.01.2010).
Kolev, Stefan (2011): Neoliberale Leitideen zum Staat. Die Rolle des Staates in der Wirtschaftspolitik im Werk von Walter Eucken, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises und Wilhelm Röpke. Dissertationsschrift an der Universität Hamburg. www.hdl.handle.net/10419/54194 (Zugegriffen am: 23.2.2015).
Lasswell, Harold D. (1934): World Politics and Personal Insecurity, Chicago: University of Chicago Press.
Lindenlaub, Dieter (1967): Richtungskämpfe im Verein für Socialpolitik, Wiesbaden: Steiner.
Lorch, Alexander (2013): Vom Ordoliberalismus zum substantiellen Liberalismus – Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung. Dissertation an der Universität St. Gallen, Bamberg: Difo-Druck.
Mannheim, Karl (1935): Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, Leiden: Gehlen.
Mirowski, Philip (1998): Economics, Science, and Knowledge: Polanyi vs. Hayek, Tradition & Discovery, The Polanyi Society Periodical 1, 29-42.
Mises Ludwig (1929): Kritik des Interventionismus. Untersuchungen zur Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart, Jena: Gustav Fischer.
Mises, Ludwig (1931): Die Ursachen der Wirtschaftskrise, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Mises, Ludwig (1932): Die Gemeinwirtschaft. Untersuchungen über den Sozialismus, Jena: Gustav Fischer.
Mises, Ludwig (1940): Nationalökonomie. Theorie des Handelns und Wirtschaftens, Genf: Editions Union.
Mises, Ludwig (1980): Planning for Freedom, and Sixteen Other Essays and Addresses, South Holland, Ill.: Libertarian Press.
Mises, Ludwig (2009): Memoirs, Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute (Translated by Arlene Oost- Zinner).
Müller-Armack, Alfred (1952): Stil und Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft. In: Goldschmidt, Niles/Wohlgemuth, M. (Hg.): Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, Tübingen 2008, 457-466.
Müller-Armack, Alfred (1956): Soziale Marktwirtschaft. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, vol. 9, 390-392.
Müller-Armack, Alfred (1958): Entwicklungsgesetze des Kapitalismus. Ökonomische, geschichtstheoretische und soziologische Studien zur modernen Wirtschaftsverfassung, Berlin: Junker & Dünnhaupt.
Müller-Armack, Alfred (1971): Auf dem Weg nach Europa – Erinnerungen und Ausblicke, Tübingen und Stuttgart: Poeschel.
Müller-Armack, Alfred (1974): Genealogie der Sozialen Marktwirtschaft: Frühschriften und weiterführende Konzepte, Sozioökonomische Forschungen, Band. 1, Bern/Stuttgart: Paul Haupt .
Müller-Armack, Alfred (1990): Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, München: Kastell (Neudruck der Ausgabe 1946).
Müller-Armack, Alfred (1996): Wirtschaftspolitik als Beruf (1918-1968). Vortrag bei der Metallergewerkschaft und den Lurgi-Gesellschaften in Frankfurt/Main m 23. Oktober 1968. In: Schneider, Jürgen/Harbrecht, Wolfgang (Hg.):Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in Deutschland (1933-1993), Stuttgart: Franz Steiner, 283-301.
Nau, Heino Heinrich (1996) (Hg.): Der Werturteilsstreit. Die Äußerungen zur Werturteilsdiskussion im Ausschuss des Vereins für Sozialpolitik (1913), Marburg: Metropolis.
Nonhoff, Martin (2005): Politischer Diskurs und Hegemonie. Das Projekt „Soziale Marktwirtschaft”, Bielefeld: transkript.
Nordmann, Jürgen (2005): Der lange Marsch zum Neoliberalismus. Vom Roten Wien zum freien Markt – Popper und Hayek im Diskurs, Hamburg: VSA.
Nützenadel, Alexander (2005): Stunde der Ökonomen. Wissenschaft, Politik und Expertenkutur in der Bundesrepublik 1949-1974, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
ORF (Hg.) (1983): Franz Kreuzer im Gespräch mit Friedrich von Hayek und Ralf Dahrendorf, Wien: Franz Deuticke.
Ötsch, Walter Otto (2007): Gottesbilder und ökonomische Theorie: Naturtheologie und Moralität bei Adam Smith. In: Jahrbuch Normative und institutionelle Grundfragen der Ökonomik, 161-179.
Ötsch, Walter Otto (2009): Mythos Markt. Marktradikale Propaganda und ökonomische Theorie, Marburg: Metropolis, 2. Auflage.
Ötsch, Walter Otto (2014): The Deep Meening of ‘Market’: Understanding Neoliberal-Market-Radical Reasoning. Human Geography 2: 11-25.
Pirker, Reinhard (2004): Märkte als Regulierungsformen sozialen Lebens, Marburg: Metropolis.
Ptak, Ralf (2004): Vom Ordoliberalismus zur Sozialen Marktwirtschaft. Stationen des Neoliberalismus in Deutschland, Opladen: Leske + Budrich.
Ptak, Ralf (2007): Grundlagen des Neoliberalismus. In: Butterwege, Christoph; Lösch, Bettina; Ptak, Ralf (Hg.): Kritik des Neoliberalismus, Wiesbaden: VS für Sozialwissenschaften, 13-86.
Pühringer, Stephan/Hirte, Katrin (2014): ÖkonomInnen und Ökonomie in der Krise?! Eine diskurs- und netzwerkanalytische Sicht, WISO 37(1), 159-178.
Quaas, Friedrun (2000): Soziale Marktwirtschaft: Wirklichkeit und Verfremdung eines Konzepts, Bern: Paul Haupt.
Quaas, Friedrun/Quaas, Georg (2013): Die Österreichische Schule der Nationalökonomie. Darstellung, Kritiken und Alternativen, Marburg: Metropolis.
Riese Hajo (1972): Ordnungsidee und Ordnungspolitik – Kritik einer wirtschaftspolitischen Konzeption, Kyklos 25 (1), 24-48.
Röpke, Wilhelm (1944): Civitas humana: Grundfragen der Gesellschafts- undWirtschaftsreform, Erlenbach und Stuttgart: Rentsch.
Röpke, Wilhelm (1952): Was lehrt Keynes? Die Revolution in der Nationalökonomie. In: Universitas Vol. 7. Heidelberg: Heidelberger Lese-Zeiten , 1285-1295.
Röpke, Wilhelm (1958): Jenseits von Angebot und Nachfrage, 2. Auflage, Erlenbach und Stuttgart: Rentsch.
Röpke, Wilhelm (1962): Epochenwende. In: (ders.): Wirrnis und Wahrheit. Ausgewählte Aufsätze, Erlenbach – Zürich – Stuttgart: Rentsch, 105-124.
Röpke, Wilhelm (1962): Epochenwende. In: (ders.): Wirrnis und Wahrheit. Ausgewählte Aufsätze. Erlenbach und Stuttgart: Rentsch, 105-124.
Röpke, Wilhelm (1965): Die Lehre von der Wirtschaft, Erlenbach und Stuttgart: Rentsch.
Röpke, Wilhelm (1979): Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, 5. Auflage, Erlenbach und Stuttgart: Rentsch.
Runge, Uwe (1971): Antinomien des Freiheitsbegriffs im Rechtsbild des Ordoliberalismus, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
Rüstow, Alexander (2004): Die Religion der Marktwirtschaft. Münster: LIT.
Rüstow, Alexander/Maier-Rigaud, Frank P./Maier-Rigaud, Gerhard (2001): Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus, 3. überarbeitete Auflage mit Übersetzungen, Marburg: Metropolis.
Smith, Adam (1776/2005): The Wealth of Nations. Pennsylvannia: State University. www.ia601703.us.archive.org/3/items/WealthOfNationsAdamSmith/Wealth%20of%20Nations_Adam %20Smith.pdf ( Zugegriffen am: 23.02.2015).
Stapelfeldt, Gerhard (2004): Geschichte der ökonomischen Rationalisierung. Kritik der ökonomischen Rationalität, 2. Auflage, Münster u.a.: LIT.
Thomasberger, Claus (2009): ‚Planung für den Markt’ versus ‚Planung für die Freiheit’. Zu den stillschweigenden Voraussetzungen des Neoliberalismus. In: Ötsch, Walter Otto; Thomasberger, Claus (Hg.), Der neoliberale Markt-Diskurs. Ursprünge, Geschichte, Wirkungen, Marburg: Metropolis, 63-96.
Thomasberger, Claus (2011): 'Sein' und 'Bewusstsein': Propaganda und 'objektive Realität' in den neoliberalen Gesellschaften. In: Ötsch, Walter Otto/Hirte, Katrin/Nordmann, Jürgen (Hg.): Gesellschaft! Welche Gesellschaft? Nachdenken über eine sich wandelnde Gesellschaft, Marburg: Metropolis, 61-91.
Thomasberger, Claus (2012): Das neoliberale Credo. Ursprünge, Entwicklung, Kritik, Marburg: Metropolis.
Vanberg, Viktor J. (1986): Spontaneous Order and Social Rules. A Critical Examination of F.A. von Hayes Theory of Cultural Evolution, Economics and Philosophy 2, 75-100.
Vietta, Silvio (2007): Europäische Kulturgeschichte, Paderborn: Fink.
Weber, Max (1922): Der Sinn der Wertfreiheit der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften. In: Weber, Max (1922), Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: J. B. C. Mohr (Paul Siebeck), 451- 502.
Wörsdorfer, Manuel (2011): Die normativen und wirtschaftsethischen Grundlagen des Ordoliberalismus. Inaugural-Dissertation am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe- Universität Frankfurt am Main.
Zapfel, Björn (2002): Die Häresie alternativer Ökonomie – Überlegungen zu den Grundlagen neoliberalen Denkens und Ansatzpunkten ökonomischer Alternativen. Dissertation an der Wirtschaftsuniversität Wien, München: Grin- .
Zweynert, Joachim (2007): Die Entstehung ordnungsökonomischer Paradigmen – theoriegeschichtliche Betrachtungen. In: HWWI Research Paper 5/2.
1 Das Problem der „Herkunft“ ist dabei in den Hintergrund getreten und wurde erst über die Humankapitaltheorie von Bourdieu wieder neu belebt: Die Ausstattung mit kulturellem und sozialem Kapital ist neben der mit ökonomischem Kapital nach Bourdieu ausschlaggebend für die Stellung und Entwicklung des Menschen in einer Gesellschaft (Bourdieu 1983, 183ff.).
2 Röpkes ideale Aristokraten geben der Gesellschaft ein leuchtendes Vorbild: „Dabei erweist sich auch die von den Menschen willig anerkannte Autorität jener dünnen Schicht einer nobilitas naturalis als unentbehrlich, in die einige wenige durch ein exemplarisches Leben der entsagungsvollen Leistung, der unantastbaren Integrität, der ständigen Bändigung des gemeinen Appetits und des höchsten allgemeinen Beispiels zu einer die Maßstäbe setzenden Stellung über den Klassen, Interessen, Leidenschaften, Bosheiten und Torheiten emporsteigen und das Gewissen der Nation verkörpern. Eine freie Gesellschaft kann ohne eine solche Zensorenklasse nicht bestehen (…).“ (Röpke 1958, 175). Lorch meint kritisch dazu: „Die Forderungen der Ordoliberalen nach bestimmten Werten und Strukturen sind im Grunde unliberal, da sie den Menschen und der Gesellschaft ganz bestimmte Werte und einen traditionellen Lebensentwurf vorschreiben. Haselbach nennt dies sehr treffend einen „autoritären Liberalismus“, der sich im Grunde weigert, die Entwicklungen der Moderne anzuerkennen. Stattdessen romantisiert (Röpke) eine Zeit des Kleinbürgertums, der ständischen Gesellschaft und der Kleinbauern, die außerhalb der wirtschaftlichen Freiheit statt einer individuellen, mündigen Freiheit eher eine Unterwerfung unter eine ‚Zensorenklasse’ betont.“ (Lorch 2013, 82, mit Verweis auf Haselbach 1991)
3 Im überarbeiteten Findbuch des Nachlasses von Alexander Rüstow (Bundesarchive Koblenz 2004, 60) findet sich z. B. folgender Eintrag „Technischer Fortschritt, Übervölkerung und Vermassung, in: Gedenkschrift für Ibrahim Hazal Palin, Istanbul 1948, 297-308“.
4 Hier zitiert nach Andrae (2012, 69ff.).
5 Mehrzahl daher, weil der so genannte Werturteilsstreit in der Nationalökonomie schon entbrannt war. Max Weber ging aus diesem damals noch ziemlich isoliert hervor; Vgl. hier z. B. Nau (1996, 51); Lindenlaub (1967); Demm (1988, 119ff.) bzw. Weber (1922, 461f.) selbst.
6 Zu Zeiten einer „ethischen Nationalökonomie“ wurde dieses elitäre Selbstverständnis noch offen und mit Selbstverständnis vertreten, wenn es z. B. von Knapp heißt, die beste politische Herrschaft sei die einer Herrschaft „(…) hochsinniger und hochgebildeter Beamten (…)“ (Knapp 1891, 86).
7 Kontingenz steht in Widerspruch zu Hayeks „Theorie“ der Evolution.
8 Hayek hat der Soziologie wiederholt eine rigide Absage erteilt. In seinem letzten Buch unternimmt er einen Rundumschlag gegen den „Rationalismus“, „Empirismus“, „Positivismus“ und „Utilitarismus“ (Hayek 1996, 57ff.). In Bausch und Bogen verdammt wird auch die Psychoanalyse u. die gesamte Soziologie: deren Unvermögen träte am „(…) kassesten (…)“ zutage, - „(…) am allerschlimmsten in der sogenannten ‚Wissenssoziologie‘“ (ebenda, 52).
9 Nordmann (2005) diskutiert dies für die Selbstdarstellungen von Hayek und Popper. Auf Popper konnte innerhalb dieses Projektes nicht näher dazu eingegangen warden.
Gehe zu: „Der Markt“ und seine Politische Ökonomie