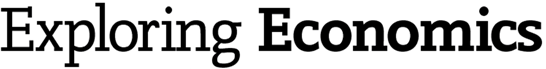Ungleiche Erzählungen
Netzwerk Plurale Ökonomik
Warum es wichtig ist, wie in den Wirtschaftswissenschaften über Ungleichheit gesprochen wird


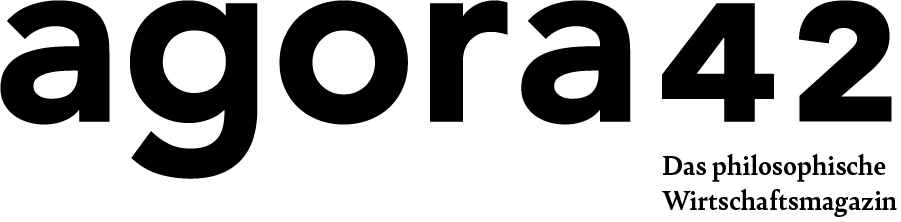
Dieser Artikel wurde auf Agora42 erstveröffentlicht.
In der Kolumne Jenseits von Angebot und Nachfrage nehmen Autor*innen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik die fachlichen Scheuklappen der Lehrbuchökonomie ab und werfen einen pluralökonomischen Blick auf gesellschaftspolitische Fragestellungen.
Ungleichheit ist derzeit eine der größten ökonomischen Herausforderungen. Sie ist nicht natürlich gegeben, sondern Produkt eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses. Um es in den Worten des Ungleichheitsforschers Thomas Piketty zu sagen: „Jede menschliche Gesellschaft muss ihre Ungleichheit rechtfertigen, […] Ungleichheitsregime […] zeichnen sich durch ein Zusammenspiel von Diskursen und institutionellen Einrichtungen aus, die der Rechtfertigung und Organisation wirtschaftlicher, sozialer und politischer Ungleichheit in den jeweiligen Gesellschaften dienen.”
Immer häufiger wird in diesem Zusammenhang auf die Rolle von Narrativen hingewiesen. Narrative sind Erzählungen, die helfen, eine Gesellschaft zu erklären oder zu rechtfertigen. Sie können gesellschaftlichen Zusammenhalt suggerieren, Zusammenhänge herstellen oder vereinfachen und neue Erklärungsmuster schaffen. Dabei wirken und verbreiten sie sich vor allem im Großen und Stillen, wobei die Notwendigkeit, sie zu hinterfragen, leicht in Vergessenheit gerät.
Narrative in den Wirtschaftswissenschaften
Auch in den Wirtschaftswissenschaften gibt es solche Narrative. Selbst Paul A. Samuelson (1915-2009), Begründer der heute stark formalisierten Lehrbuchökonomie, betonte die Bedeutung von Sprache, da sie Emotionen hervorrufe und Tatendrang wecke. In seinen Lehrbüchern, die auch heute noch zu den einflussreichsten gehören, findet sich dazu allerdings nichts. Stattdessen stehen mathematische und grafische Analysen, wie das Angebots- und Nachfragediagramm, im Fokus. Daran hat sich in den letzten Jahrzehnten wenig geändert. Sprache bestimmt jedoch unseren Blick auf Ökonomie mit: Durch eine spezifische Wahl von Sprache ist es möglich, komplexe Konzepte und Zusammenhänge an ein bestimmtes Erfahrungswissen anzubinden und alternative Erfahrungen außer Acht zu lassen. Auch die Möglichkeiten der Deutung und Interpretation von Phänomenen können eingegrenzt werden.
Inzwischen findet die Forderung nach einer Reflexion der Sprache in den Wirtschaftswissenschaften allerdings vermehrt Gehör. Silja Graupe, Leiterin des Instituts für Ökonomie an der Cusanus Hochschule, untersucht in ihrer Forschung die Bedeutung von Sprache in der ökonomischen Bildung und das Konzept von gedanklichen Rahmen, auch „Frames“ genannt. Ihr zufolge tragen die meisten ökonomischen Lehrbücher dazu bei, dass Studierende nicht über den Tellerrand – also den Frame – hinausdenken, sondern nur das sehen können, was sich auf diesem Teller – also innerhalb des Frames – befindet. Dadurch besteht die Gefahr, dass Studierende nur sehr limitiert über zentrale ökonomische Aspekte wie Armut, Machtverhältnisse oder Ungleichheit sprechen und sich ausdrücken können.
Auch Daniel Kahneman (*1934) und Amos Tversky (1937-1996), zwei Psychologen, von denen Ersterer den „Wirtschaftsnobelpreis” erhielt, rücken in ihrer Forschung den sogenannten Framing-Effekt in den Vordergrund. Dieser beschreibt die Tatsache, dass die Art und Weise, wie etwas formuliert wird, zu einer Veränderung von Präferenzen, also Vorlieben, führen kann. Auch der amerikanische Ökonom Robert Shiller (*1946) schreibt in seinem Buch „Narrative Wirtschaft” über die Relevanz von kollektiven Erzählungen, mit deren Hilfe über die Recht- oder Unrechtmäßigkeit von ungleichen Verteilungen und ihren Ursachen diskutiert wird.
Eine Erzählung davon, wer was „verdient”
Was das Thema der Ungleichheit angeht, lassen sich in den Wirtschaftswissenschaften eine ganze Reihe von impliziten Narrativen herausarbeiten. Ein Narrativ, welches dabei eine große Rolle spielt, ist wie über Gerechtigkeit und Erfolg gesprochen wird. Im politischen Diskurs gibt es dahingehend unterschiedliche Perspektiven. Aus der Perspektive wirtschaftsliberaler Parteien entlohnt der Markt Leistungen. Demnach haben gut ausgebildete Menschen mehr in ihre Ausbildung investiert und bessere Entscheidungen getroffen. Sie leisten mehr und haben im wahrsten Sinne des Wortes mehr verdient. Nach diesem Narrativ ist es gerecht, wenn sie hoch entlohnt werden. Linke Parteien sprechen anders über Ungleichheit: Gut ausgebildete Menschen hatten das Privileg eine gute Ausbildung zu absolvieren und können in der Gesellschaft dadurch Aufgaben übernehmen, die geringe Risiken, hohe Anerkennung und gute Bezahlung mit sich bringen. Wer schlechter ausgebildet ist, muss häufig gefährlichere Aufgaben übernehmen, die weniger anerkannt und schlechter bezahlt sind, während sie/er mindestens gleichermaßen gesellschaftlich Relevantes leistet.
Das (wirtschaftsliberale) Narrativ, gut ausgebildete Menschen hätten vor allem gute Entscheidungen getroffen, zieht sich durch einen auffällig großen Teil der wirtschaftswissenschaftlichen Praxis. Dies spiegelt sich unter anderem darin wieder, dass Begriffe wie Leistung, Leistungsgerechtigkeit, Humankapital und Eigenverantwortung sehr präsent sind, während Begriffe wie Privilegien, Klasse, Diskriminierung und wirtschaftliche Notwendigkeit kaum Verwendung finden.
Vorlieben oder Notwendigkeiten?
Ein weiteres wichtiges Konzept, das einen starken Frame schafft, ist das der „revealed preferences”.
Diesem Konzept nach sollte man Individuen nicht fragen, sondern beobachten, wenn man etwas über sie erfahren möchte. Die Annahme ist, dass ihre Handlungen ihre tatsächlichen Vorlieben oder Präferenzen besser zum Ausdruck bringen. Es wird davon ausgegangen, dass Menschen nur das machen, was für sie am besten und somit das Resultat ihrer Nutzenmaximierung ist. Wissenschaftstheoretisch kann man über diese Herangehensweise streiten – wie alle Methoden hat sie Vor- und Nachteile. Das Konzept hat allerdings eine zweite Dimension, und diese besteht in dem Narrativ, dass sie mitliefert. Diese zweite, narrative Dimension drückt sich darin aus, dass Menschen nach Vorlieben und nicht nach Notwendigkeiten handeln. Gerade Menschen, die nicht die Privilegien unzähliger freier Entscheidungen und Möglichkeiten genießen, erleben häufig eine andere Realität. Vielleicht drückt eine Frau, die sich zu Hause um ihr Kind kümmert, nicht die Vorliebe dafür aus. Vielleicht zeigt sich in ihrem Verhalten lediglich die Notwendigkeit, zu Hause bleiben zu müssen. Notwendigkeiten und nicht Vorlieben können auch dazu führen, dass keine Informationen über vertretbare Alternativen gesammelt werden können. Die Situation dieser Frau als freie Entscheidungssituation zu framen, verdeckt den Blick auf materiell und gesellschaftlich bedingte Notwendigkeiten.
Der Mangel an Bildern
Dazu kommt, dass ökonomische Modelle sehr formalisiert sind und oft in abstrakten Konzepten und mathematischer Sprache mit wenigen Bildern gefasst werden. Diese Konzepte transportieren jedoch häufig eine bestimmte Perspektive, ohne dabei Bilder von den Lebensrealitäten zu vermitteln. Wo man außerhalb der Modellwelt vielleicht arm oder arbeitslos sagen würde, heißt es in Modellen schlechter gestellt oder null Arbeitsstunden. Ökonom*innen übertragen die Sprache ihrer Modelle – gerade auch in der Lehre – oft auf die Art, wie sie generell die Realität beschreiben. Was neutral klingt, entzieht Sachverhalten daher oft die Problematik: Es verhindert, dass Studierende unterschiedliche Aspekte und Dimensionen von Armut oder Arbeitslosigkeit im Kopf haben. Es kann schnell passieren, dass die Dringlichkeit verloren geht, die diesen Wörtern und Sachverhalten eigentlich innewohnt.
Reden wir darüber, wie wir darüber reden
Narrative müssen sichtbar gemacht und vermehrt thematisiert werden. Geschieht dies nicht, werden diese Narrative unbewusst immer wieder genutzt und weiterverbreitet. Dadurch besteht die Gefahr, dass beispielsweise in der wirtschaftswissenschaftlichen Lehre einseitige Konzepte und bestimmte Erfahrungen als absolut angesehen und alternative Betrachtungsweisen außen vor bleiben. Problematisch daran ist auch, dass die jeweiligen Narrative bestimmte Interessen fördern und andere negieren können. Narrative, besonders jene, die implizit vermittelt oder angeeignet werden, haben direkte Folgen – zum Beispiel wie über Ungleichheit, Armut und Arbeitslosigkeit gesprochen, gedacht und darauf folgend gehandelt wird. Eine kritische Auseinandersetzung mit Narrativen könnte der Ökonomik ebenfalls helfen, sich als reflektierte Wissenschaft zu behaupten und sich dagegen zu wehren, von politischen Interessen vereinnahmt zu werden.
Auch wir greifen in diesem Text auf Narrative zurück: beispielsweise das des Wandels, der Reflektion und der Vielfalt. Die Reflexion von Begriffen und Konzepten in der ökonomischen Lehre nimmt auch in den jüngst vom Netzwerk Plurale Ökonomik veröffentlichten Impulsen für eine zukunftsfähige Ökonomik einen prominenten Platz ein. Denn: Narrative sind beständig. Sie entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern werden (un)bewusst von Menschen geschaffen. Diesen Prozess nachvollziehen und verstehen zu können, versetzt uns in die Lage, Narrative zu ändern oder uns bewusst dafür zu entscheiden, sie beizubehalten. Die Schaffung von öffentlicher Aufmerksamkeit für dieses Thema ist wichtig – jedoch langwierig. Die Schaffung von Verständnis und Bewusstsein im Rahmen der ökonomischen Lehre hingegen ist leichter umzusetzen und längst überfällig.

Henri Schneider studierte Volkswirtschaftslehre und Politik in Lüneburg und ist seit 2018 im Vorstand des Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. Darüber hinaus interessiert er sich für Finanzkrisen und Klimaökonomik.
Henrika Meyer studiert in Rotterdam Policy Economics im Master und interessiert sich unter anderem für das Thema Klimaökonomik. Überdies engagiert sie sich im Netzwerk Plurale Ökonomik.
Julia Schmid arbeitet an der Universität Hohenheim in Stuttgart als wissenschaftliche Mitarbeiterin und forscht unter anderem zu den Themen Ungleichheit, soziale Mobilität und Staatswahrnehmung. Nebenbei ist sie im Netzwerk Plurale Ökonomik aktiv.
Von den Autor*innen empfohlen:
| SACH-FACHBUCH | ROMAN | FILM | ||
|---|---|---|---|---|
| Kübra Gümüsay: Sprache und Sein (Hanser Berlin Verlag, 2020) Elisabeth Wehling: Politisches Framing (Herbert von Halem Verlag, 2016 |
Bertolt Brecht: Leben des Galilei (Suhrkamp Verlag, 1963) Bernardine Evaristo: Girl, Woman, Other (Hamish Hamilton, 2019) |
Fences (Regie: Denzel Washington, 2016) |