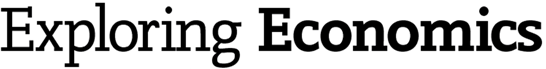Von Klimagutscheinen, Ungleichheit und Holidays4Future
Economists for Future, 2020




Im Angesicht der Klimakrise und der Fridays-for-Future-Proteste hat das Netzwerk Plurale Ökonomik unter #Economists4Future dazu aufgerufen, Impulse für neues ökonomisches Denken zu setzen und bislang wenig beachtete Aspekte der Klimaschutzdebatte in den Fokus zu rücken. Dabei geht es beispielsweise um den Umgang mit Unsicherheiten und Komplexität sowie um Existenzgrundlagen und soziale Konflikte. Außerdem werden vielfältige Wege hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaftsweise diskutiert – unter anderem Konzepte eines europäischen Green New Deals oder Ansätze einer Postwachstumsökonomie. Hier finden Sie alle Beiträge, die im Rahmen der Serie erschienen sind.
Von Klimagutscheinen, Ungleichheit und Holidays4Future
Katharina Bohnenberger
Erstveröffentlichung im Makronom
Momentan findet in der Klimapolitik eine Verzögerungstaktik unter dem Vorwand „sozialer“ Gestaltung der Klimapolitik statt. Beispielsweise reichen die Maßnahmen des Klimapaketes der deutschen Bundesregierung bei weitem nicht aus, um auch nur in die Nähe der Klimaziele von mindestens minus 55 Prozent Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 1990 zu kommen. Einige Interessensgruppen versuchen diese Klimaziele nun noch weiter zu verwässern. Häufig nutzen sie dafür auch Argumente, die untermauern sollen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen unsozial seien.
Zugegeben, mit der Erhöhung der Pendlerpauschale, der Absenkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets und einer Prämie für Elektroautos hat sich die Koalition zielsicher aus all den verfügbaren Maßnahmen diejenigen ausgesucht, die klimapolitisch minimal wirksam und sozialpolitisch maximal unglücklich sind. Denn sie führen zu mehr anstatt weniger Verkehr und bieten vor allem hochmobilen und einkommensstarken Bevölkerungsschichten Vorteile.
Noch unsozialer wäre es jedoch, eine noch uneffektivere Klimapolitik zu machen. Der Grund dafür liegt in einem Zusammenhang von Ungleichheit und Klimawandel, den der englische Wissenschaftler Ian Gough im Journal of Social Policy unter dem Begriff „Dreifache (Un-)gerechtigkeit“ erläutert: Der ärmere Teil der Bevölkerung
- trägt am wenigsten zum Klimawandel bei,
- leidet am meisten unter seinen Folgen und
- muss – wenn Klimaschutzmaßnahmen schlecht gestaltet werden – den größten Anpassungsaufwand tragen.
Letzterer Punkt wird momentan in der deutschen Kilmaschutz-Debatte heiß debattiert. Die Debatte beschränkt sich jedoch meist auf die Frage, wer die Transformationskosten trägt und ob weniger Transformationsanstrengungen nicht sozial gerechter wären.
Sozial ist, was Klimaschutz schafft
Was dabei allzu oft vergessen wird: Klimaschutz ist präventive Sozialpolitik, denn ohne Klimaschutz sind es die Ärmsten, die noch schlechter gestellt werden. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen leben häufiger in Gebieten, die ein zunehmendes Risiko für Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen aufweisen. Extremwetterereignisse wie Hitzewellen sind für Kinder, Ältere oder Kranke besonders gefährlich. Außerdem besitzen einkommensschwache Personengruppen weniger finanzielle Mittel, um vorsorgende Maßnahmen gegen diese Schäden zu ergreifen oder nach einem Schaden wieder zur Normalität zurückzukehren. Soziale Klimapolitik ist deswegen in erster Linie ambitionierter Klimaschutz.
Außerdem lässt sich hinterfragen, ob Klimaschutz tatsächlich vor allem mit zusätzlichen Kosten einhergeht oder nicht eher der (Netto-)Nutzen überwiegt. Viele Klimaschutzmaßnahmen stellen für den Großteil der Bevölkerung einen Vorteil dar. Eine Mobilitätswende durch Tempo-30-Zonen ermöglicht angstfreies Fahrradfahren für Groß und Klein. Eine Ernährungswende durch vegane Standard-Menüs ermöglicht es auch Menschen mit Laktose-Unverträglichkeit einfach mitzuessen. Und ein Recht auf Wohnungstausch kann nicht nur den Ressourcen- und Energieverbrauch im Gebäudesektor senken, sondern ermöglicht es Menschen auch platzsparend und kostenneutral in ihrem Viertel wohnen zu bleiben. Solche Maßnahmen sind eigentlich für (fast) alle gut, auch fürs Klima. Wer davon natürlich nicht profitiert, sind die Automobilwirtschaft, die Tierhaltungsindustrie und die Immobilienwirtschaft. Erfolgreiche Klimapolitik scheut sich nicht davor, diese Verteilungsfrage zu stellen.
Im Fall von „lock-in Emissionen“ ergibt es Sinn, dass der Staat die Betroffenen finanziell beim Umstieg auf klimafreundliche Lösungen unterstützt. Politikmaßnahmen, die umweltpolitisch effektiv und sozial förderlich sind, werden als öko-soziale Politiken („eco-social policies“) bezeichnet. Die meisten gehen vom Konzept der Suffizienz aus (z.B. Linz 2015). Der Begriff „Suffizienz“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „genügen“. Mit der Idee des „Genug“ gehen zwei Grenzen einher: eine die verhindert, dass es „zu wenig“ und eine, dass es „zu viel“ gibt. In der neoklassisch-geprägten Umweltökonomik, die momentan die ökonomische Perspektive auf ökologische Herausforderungen dominiert, gibt es hingegen keinen Platz für Suffizienzpolitik. Denn für sichere Mobilität, gemeinschaftliches Essen und belebte Nachbarschaften gibt es keine Märkte und vor allem keine, die sich für Benachteiligte zu schaffen lohnen. Und so werden viele Umweltschutzmaßnahmen, die eine Umverteilung zu Gunsten benachteiligter Bevölkerungsgruppen oder monetär nicht messbare Vorzüge bereitstellen, fälschlicherweise mit Verzicht gleichgesetzt.
Ökonomische Ungleichheit erfordert ungewöhnliche Klimaschutzmaßnahmen
Mit dieser Perspektive entgeht der Umweltökonomik ein für die Politikgestaltung wichtiger Fakt: Hohe Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen können sowohl aus Luxus als auch aus Armut resultieren. Letzteres ist der Fall, wenn Personen auf Grund fehlenden Einkommens auf emissionsintensive Technologien angewiesen sind oder sich klimafreundliche Produkte, wie beispielsweise regionale Bioprodukte oder energieschonende Haushaltsgeräte, nicht leisten können.
Im Fall solcher „lock-in Emissionen“ ergibt es Sinn, dass der Staat die Betroffenen finanziell beim Umstieg auf klimafreundliche Lösungen unterstützt. Durch Programme wie den Stromsparcheck, bei dem einkommensarme Haushalte auch energiesparendere Leuchtmittel erhalten, findet dies bereits in Ansätzen statt. Möglich wäre es auch, eine echte Abwrackprämie von beispielsweise 1.000 Euro als Klimagutschein auszubezahlen, die für die Anschaffung eines (Elektro-)Fahrrads oder als Gutschein im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden darf, wenn dafür im Gegenzug der Pkw abgeschafft wird. Dies verhindert, dass Personen aus finanziellen Gründen weiter Autofahren, obwohl sie sich gerne umweltfreundlicher bewegen möchten.
Einkommensstarken Personengruppen können sich von der Lenkungswirkung eines CO2-Preises freikaufen. Ganz anders gelagert sind die Herausforderungen, wenn hohe Emissionen die Ursache von übermäßigem Einkommen und Vermögen sind. Beispiele für solche Luxusemissionen sind Wochenend-Flugreisen, (Elektro-)SUVs und anderer Status-Konsum. Eine gleichmäßigere Einkommens- und Vermögensverteilung würde einige dieser Emissionen verhindern. Deswegen schlagen einige Wissenschaftler*innen aus Gründen des Umweltschutzes, neben einem Grundeinkommen, auch ein Maximaleinkommen vor (Buch-Hansen/Koch 2019). Theoretisch könnte kurzfristig auch ein hinreichend hoher CO2-Preis Anreize für klimafreundlicheres Handeln setzen. Praktisch ist ein angemessener CO2-Preis von ca. 180 Euro pro Tonne CO2-Äquivalent momentan aber politisch nicht umsetzbar. In der Konsequenz reicht es derzeit nur für einen CO2-Preis in kaum wirksamer Höhe.
Die Wirksamkeit des CO2-Preises wird auch noch durch einen anderen Grund gemindert, der seine Ursache erneut in der Einkommensungleichheit hat. Bereits seit 1977 ist bekannt, dass Preismechanismen in ungleichen Gesellschaften schlechter wirken („Weitzman-Paradox“). Denn der Anreiz von Preisen wirkt relativ zum verfügbaren Einkommen der betroffenen Person. Die Lenkungswirkung, beispielsweise eines CO2-Preises von 180 Euro pro Tonne, fällt für Vielverdiener schwächer aus als für Geringverdiener. Und sie wirkt auf doppelte Weise entgegen der erwünschten Richtung: Von einkommensstarken Personengruppen erwarten wir auf Grund ihrer höheren finanziellen Kapazitäten grundsätzlich mehr Beteiligung an Veränderungsprozessen wie dem Klimaschutz. Außerdem sind reichere Bevölkerungsgruppen durchschnittlich für höhere Treibhausgasemissionen verantwortlich. Sie haben damit das größere Reduktionspotential und wir erwarten nach dem Verursacherprinzip von ihnen auch die größte Veränderung. Von der Lenkungswirkung eines CO2-Preises können sie sich aber durch ihr höheres Einkommen freikaufen.
Holidays4Future: Urlaub für den Klimaschutz
Aus diesem Grund sollte man über einen Anreizmechanismus nachdenken, der für alle gleich starke Anreize zum Klimaschutz schafft und insbesondere für vermögendere Personengruppen nicht ineffektiv bleibt. Eine Ressource, in der wir einander alle gleichen, ist die Zeit: 8.760 Stunden hat jeder Mensch im Jahr zur Verfügung. Zeit ist für alle gleich knapp und für Vermögende vielleicht noch etwas knapper, denn sie haben durch höheres Einkommen vielfältigere Möglichkeiten, ihre Zeit nutzenstiftend zu verbringen. Ein neuer klimapolitischer Ansatz wäre, geringere Treibhausgasemissionen mit zusätzlicher Freizeit zu belohnen. Der Informationsdienstleister Posteo geht bereits diesen Weg und bietet seinen Beschäftigten zusätzliche Urlaubstage, wenn sie nicht mit dem Flugzeug fliegen.
Auch deutschlandweit könnte man einen entsprechenden „Holidays4Future“-Mechanismus institutionalisieren. Bei einem CO2-Preis von 180 Euro/Tonne und einem Bruttoverdienst von 24,06 Euro/Stunde (Durchschnittswert einer/eines Arbeitnehmenden), würde klimaschädliches Handeln richtig zeitintensiv: Für durchschnittliche 11 Tonnen Gesamtemissionen je Person und Jahr müsste man circa 82 Stunden lang seine Klimakosten abarbeiten, oder kann, wenn man seine Emissionen reduziert, bis zu zwei Wochen zusätzlichen Urlaub bekommen. Dann würde auch genug Zeit bleiben, um mit dem Zug statt dem Flugzeug in den Urlaub zu reisen. Ein neuer klimapolitischer Ansatz wäre, geringere Treibhausgas-Emissionen mit zusätzlicher Freizeit zu belohnen.
Kurzfristig würde sich ein CO2-Preis auch allein schon dadurch sozialer und effektiver gestalten lassen, wenn er immer noch zur Hälfte (90 Euro/Tonne) produktionsbasiert angerechnet wird und zur anderen Hälfte konsumbasiert. Letzteres ließe sich in zusätzliche, emissionsabhängige Prozentpunkte bei der Steuer auf Einkommen und Vermögen übersetzen. Dies würde zwar mit zusätzlichem Messaufwand für die individuellen Treibhausgasemissionen einhergehen. Im Sinne der Kohlenstoffgerechtigkeit („Carbon Justice“) sollte aber sowieso jeder wissen, was sein/ihr Emissionsniveau ist und welche Lebensbereiche das größte Minderungspotential aufweisen. Möchte man sich bei der Steuerhöhe dabei an dem Zeitaufwand für die Erarbeitung der Klimaschuld orientieren, würde die Klimasteuer bei 11 Tonnen knapp 0,4 Prozentpunkte betragen – bei klimaschädlichen Lebensstilen entsprechend mehr, bei klimafreundlichen entsprechend weniger.
Dieser Wert wäre für alle Menschen gleich, die das gleiche Emissionsniveau haben und damit wesentlich gerechter als bisherige Vorschläge zum CO2-Preis, tendenziell regressiv wirken, also einkommensschwächere Haushalte stärker belasten als einkommensstärkere (DIW 2019). Im Vergleich zu Vorschlägen, die eine Rückerstattung durch eine Pauschale ansetzen, setzt dieser Vorschlag stärkere Anreize für einkommensstarke Personengruppen: Der absolute CO2-Preis steigt bei diesem Konzept mit der Höhe des Einkommens. Anstatt mit den Einnahmen klimaschädliche Lebensstile (z.B. durch eine Pendlerpauschale) leistbar zu halten und damit zu zementieren, können die Einnahmen als Klimagutscheine zur Überwindung von lock-in Emissionen, wie sie oben beschrieben wurden, rückerstattet werden.
Diese Beispiele zeigen: Je nachdem, wie ungleich eine Gesellschaft ist und ob Treibhausgasemissionen Ursprung eines lock-ins oder Luxusemissionen sind, sind unterschiedliche Maßnahmen adäquat. Und damit schließt sich der Kreis wieder: Nicht nur die Frage nach sozialverträglicher Klimapolitik gilt es für eine erfolgreiche und sozial gerechte Transformation zu beantworten – sondern auch, wie eine klimafreundliche Sozialpolitik aussieht.
Zur Autorin:
Katharina Bohnenberger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen. Dort forscht sie zum Zusammenhang von Umwelt- und Sozialpolitik. Sie ist Mitglied des Internationalen Netzwerks Suffizienzforschung (ENOUGH) und der Arbeitsgemeinschaft sozial-ökologische Arbeits- und Zeitforschung. 2018 gründete sie mit anderen Wissenschaftler*innen das internationale Forschungsnetzwerk Sustainable Welfare, dessen Ziel es ist, Klimaschutz und soziale Fragen strukturell zusammen zu denken. Auf Twitter: @k_bohnenberger
Wir bieten eine Plattform für Artikel und Themen, die in der Mainstream-Ökonomik vernachlässigt werden. Dafür sind wir auf Deine Unterstützung angewiesen.