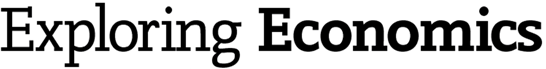Das Ordnungsverständnis in wirtschaftspolitischen und theoriegeschichtlichen Lehrbüchern
Wirtschaft neu denken: Blinde Flecken in der Lehrbuchökonomie, 2016
Das Ordnungsverständnis in wirtschaftspolitischen und theoriegeschichtlichen Lehrbüchern
Roland Fritz und Nils Goldschmidt
Rezensierte Bücher:
van Suntum, U. (2013): Die unsichtbare Hand – Ökonomisches Denken gestern und heute, 5. Auflage, Berlin: Springer, 330 Seiten. Im Folgenden zitiert als UVS. (Abb: Springer-Verlag Berlin-Heidelberg)
Blankart, C.B. (2011): Öffentliche Finanzen in der Demokratie – Eine Einführung in die Finanzwissenschaft, 8. Auflage, München: Vahlen, 790 Seiten. Im Folgenden zitiert als CB. (Abb: Vahlen)
Apolte, T. et al. (2007): Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 1, 9. Auflage, München: Vahlen, 750 Seiten. Im Folgenden zitiert als VKI. (Abb: Vahlen)
Apolte, T. et al. (2007): Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 2, 9. Auflage, München: Vahlen, 724 Seiten. Im Folgenden zitiert als VKII. (Abb: Vahlen)
Die zur Rezension ausgewählten Lehrbücher sind schon allein deswegen bemerkenswert, weil sie sich überhaupt mit ordnungspolitischen und institutionellen Fragestellungen beschäftigen, was nach wie vor noch nicht als state of the art in den Wirtschaftswissenschaften gelten kann. Bei allen drei Büchern spielt das Feld der Politischen Ökonomie (zumindest stellenweise) eine Rolle, und es wird versucht, auch nicht-ökonomische, vor allem gesellschaftliche Sachverhalte in den Diskurs miteinzubeziehen. Das Gespür dafür, dass es neben der neoklassisch geprägten Mainstream-Ökonomik auch noch andere – möglicherweise für das Verständnis von menschlichem (Wirtschafts-)Handeln besser geeignete – Ansätze gibt, ist bei den Autoren der hier besprochenen Bücher fraglos vorhanden.
Im Folgenden wird es unser Ziel sein, die drei oben genannten Publikationen auf den in ihnen verwendeten Ordnungsbegriff zu untersuchen. Zum einen, um so aufzuzeigen, ob und wie in diesen Büchern ordnungsökonomisch gedacht wird. Zum anderen, um darzulegen, wie Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik von einer tiefergehenden Beschäftigung mit ordnungspolitischen Inhalten profitieren könnten. Zudem soll geprüft werden, ob mit der Verwendung von ordnungspolitischen Konzepten möglicherweise auch versucht wird, gewisse (gesellschafts-)politische Positionen zu untermauern.
Ordnung durch die unsichtbare Hand?
„Die unsichtbare Hand“ von Ulrich van Suntum zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es in einer unkomplizierten und auch für den ökonomischen Laien gut verständlichen Sprache verfasst ist. Darüber hinaus verzichtet das Buch vollständig auf mathematische Darstellungen, was der Verständlichkeit für ein breites Publikum ebenfalls zuträglich ist. Komplizierte Sachverhalte und das Ordnungsdenken in der Ökonomik werden den Leser_innen hier auf eine einfache – manchmal vielleicht zu sehr vereinfachende – Weise nahegebracht. Im Folgenden sollen einige kritische Anmerkungen vorgebracht werden, die aber den positiven Gesamteindruck nur wenig schmälern. Beispielsweise muss hier und da bezweifelt werden, ob in der Darstellung von van Suntum das Konzept der Ordnung den Leser_innen immer präzise vermittelt wird. So wird auf Seite 248 ein wenig plattitüdenhaft konstatiert: „Ordo heißt so viel wie Ordnung.“ Ferner liest man auf derselben Seite, dass der Staat laut Eucken bei der Gestaltung von Wirtschaftspolitik einen Datenkranz vorgeben solle, an dem sich die wirtschaftenden Akteurinnen und Akteure orientieren könnten. Diese Interpretation des Begriffs „Datenkranz“ ist ganz sicher nicht im Eucken’schen Sinne, der damit viel mehr das wirtschaftliche, soziale wie kulturelle Umfeld, in welchem die handelnden Akteurinnen und Akteure ihre Entscheidungen treffen, gemeint hatte. Eucken ging es um das Wechselspiel zwischen dem Wirtschaftsprozess (als Gegenstandsbereich der ökonomischen Theorie) und den ökonomisch nicht erklärbaren, auf das wirtschaftliche Geschehen wirkenden Daten, um so die Dynamik zwischen beiden „Sphären“ zu analysieren. Jedoch kann die Wirtschaftspolitik auf die Daten wirken.[1]
Unter Ordnungspolitik versteht van Suntum, „die Rahmenbedingungen und Anreize für privates Handeln so zu setzten, dass sie möglichst automatisch zu den gewünschten Ergebnissen führen“ (UVS, S. 297). Als Analogie bietet van Suntum hier die Legende von Herkules an, der – mit der schier unerfüllbaren Aufgabe konfrontiert, den Stall des Augias zu säubern – kurzerhand zwei Flüsse durch den Stall umleitete und sich somit natürlicher Kräfte bediente, um seine Aufgabe zu erledigen. In gleicher Weise schlägt van Suntum nun vor, dass Ordnungspolitik versuchen müsste, die natürlichen Neigungen von Menschen so zu kanalisieren, dass daraus Resultate entstehen, die gesamtgesellschaftlich als wünschenswert erachtet werden können. Dieses Bild ist sicherlich nicht unpassend (auch wenn in der modernen Ordnungs- beziehungsweise Konstitutionenökonomik eher der sich selbst bindende Odysseus bemüht wird, um aufzuzeigen, dass die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung im langfristigen Interesse der Individuen liegt), jedoch bleibt unklar, wie die wirtschaftliche Ordnung entsteht und sich wandelt, und wie wettbewerbsbeschränkende Eingriffe begründet werden. Ordnungspolitik bedeutet immer auch, sich gegen (kurzfristige) Interessen einzelner Individuen zu stellen, wie zum Beispiel im Kartellrecht oder durch Eingriffe in die Eigentumsordnung im Rahmen sozialpolitischer Arrangements. Etwas überraschend ist zudem, dass van Suntum als erste Maßnahme zur Implementierung eines stabilen Ordnungsrahmens Friedrich A. von Hayeks Vorschlag zur Trennung der Regierungsgewalt durch zwei Kammern anführt (von denen eine das politische Tagesgeschäft besorgt, während sich die andere mit der Erstellung des langfristigen Ordnungsrahmens befasst). Freilich ist Hayeks Idee diskutabel, jedoch ist sie kaum eine ordnungspolitische Notwendigkeit, zumal eine so tiefgreifende Änderung des politischen Systems in der Praxis eher schwerlich zu realisieren wäre.
Van Suntum legt an manchen Stellen auch eine etwas gewöhnungsbedürftige Interpretation gewisser allgemeiner ökonomischer Zusammenhänge und Theorien an den Tag: So bezieht er den Rawls’schen „Schleier des Nichtwissens“ einzig auf die hypothetische Zustimmung, die Individuen einem gewissen marktlichen und rechtlichen Regelwerk geben würden, ohne auf die sozialpolitischen Schlussfolgerungen dieses Konzepts einzugehen (vgl. UVS, S. 257). Zwar wird an dieser Stelle auch kurz der Name James Buchanan genannt, es wäre aber wert gewesen, hier die Bedeutung der Public-Choice-Theorie und der Konstitutionenökonomik für eine moderne Ordnungstheorie zu diskutieren, wie sie beispielsweise Viktor Vanberg vorgelegt hat. Darüber hinaus wird aus dem Arrow-Theorem gefolgert, dass „wann immer eine marktmäßige Lösung ökonomischer Wahlprobleme möglich ist, [...] sie der politischen Lösung über Mehrheitsabstimmungen grundsätzlich vorzuziehen“ ist (UVS, S. 256), obwohl Arrow diese Interpretation seiner Ergebnisse selbst in keiner Weise nahegelegt hatte (vgl. Arrow 1950, S. 344–345) und vom heutigen Forschungsstand aus die Überwindung der Arrow’schen Problemstellung durchaus durch einen vermehrten Rückgriff auf the wisdom of crowds – und damit eigentlich auf einen verstärkten Gebrauch von politischen Lösungen – möglich scheint (vgl. unter anderem Landemore 2012 und Page 2007).
Auf der Habenseite steht bei van Suntum aber fraglos der häufige und wohlwollende Bezug auf die Wichtigkeit von Ordnungsökonomik sowie (natürlicherweise bei einem dogmenhistorisch inspirierten Lehrbuch) Verweise auf theoriegeschichtliche und wirtschaftshistorische Zusammenhänge. So ist zum Beispiel Ludwig Erhard und seine Wirtschaftspolitik in den späten 1940er und 1950er Jahren ein wiederkehrendes Thema (vgl. unter anderem UVS, S. 18 und S. 113), es werden aber auch Franz Böhm (UVS, S. 294) und Alfred Müller-Armack (UVS, S. 267), die im gegenwärtigen Diskurs eher ausgespart werden, erwähnt. Auch die Betonung von Interdisziplinarität im ökonomischen Denken sowie die fundamentale Wichtigkeit von ökonomischen Wissen für politische und rechtliche Entscheidungen ist sehr zu begrüßen.
Vahlens Kompendium: Enzyklopädie mit ordnungsökonomischen Wurzeln
Die von verschiedenen Autoren in beiden Bänden von „Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik“ verfassten Beiträge sind aus ordnungsökonomischer Sicht vielfach gelungen. Wenn Heinz Grossekettler (VKI, S. 701) festhält, dass „es […] das Verdienst des Ordoliberalismus [sei], gezeigt zu haben, dass funktionsfähige Märkte keine Selbstverständlichkeit sind, sondern das Ergebnis einer zweckmäßigen Wettbewerbsordnung“, benennt er die zentrale Einsicht ordnungsökonomischen Denkens, die in der heutigen Einführungsliteratur in die Volkswirtschaftslehre aber kaum eine Rolle spielt. Wettbewerb stellt sich nicht in irgendeiner Weise „naturwüchsig“ ein, sondern ist eine bleibende politische Aufgabe. Aus ordnungspolitischer Hinsicht aufschlussreich ist auch Jörg Thiemes Kapitel über Wirtschaftssysteme (vgl. VKI, S. 1–52), welches unter anderem einen groben – aber äußerst hilfreichen und zugänglichen – Überblick über die gesellschaftliche Einbettung von wirtschaftlicher Tätigkeit (VKI, S. 3–7), die Koordinationsfunktion von Märkten (VKI, S. 17–26) und die ordnungstheoretischen Unterschiede zwischen verschiedenen Wirtschaftssystemen (VKI, S. 7–16) gibt, wobei durchwegs ein starker Bezug zur traditionellen deutschen Ordnungsökonomik, insbesondere zu Walter Eucken und dessen Schüler Karl Paul Hensel ersichtlich ist. Als absoluter Kostenvorteil des Buches muss gelten, dass explizit auf die polit-ökonomische Transformationsforschung Bezug genommen wird (VKI, S. 43–48). Hier findet man eine aufschlussreiche Diskussion jener Aspekte, die zum Verständnis der Transformation der Länder des ehemaligen Ostblocks hin zu eher marktwirtschaftlichen Systemen im Laufe der 1990er Jahre unerlässlich waren und sind. Auf vergleichbare Darstellungen wird man in anderen einführenden Wirtschaftslehrbüchern eher selten stoßen, obwohl man sich gewünscht hätte, dass die aktuelle und umfängliche (englischsprachige) Literatur zum Thema mehr berücksichtigt worden wäre.
Eine Ausnahme zu diesem prinzipiell positiven Eindruck von Vahlens Kompendium stellt vor allem das Kapitel G (VKI, S. 396–474) von Dieter Bender dar, das sowohl die Wachstumstheorie als auch – wesentlich schwerwiegender – die Entwicklungsökonomik ohne Rückgriffe auf kultur- und institutionsökonomische Sachverhalte behandelt. Im 25-seitigen Unterkapitel über „entwicklungsfördernde Politik“ werden institutionelle Fragen lediglich auf eineinhalb Seiten behandelt und die Reform sowie Neubildung von politischen Institutionen wird gleichgeordnet neben einer Vielzahl anderer entwicklungsfördernder Maßnahmen (Handelsliberalisierung, Privatisierung/Deregulierung, Finanzmarktliberalisierung, ausländische Direktinvestitionen etc.) als einer von vielen Punkten angegeben, die von Politiker_innen aus sich entwickelnden Staaten verbessert werden müssten. Die Information, dass der Erfolg solcher Maßnahmen eng an kulturelle, historische und institutionelle Bedingungen geknüpft ist und diese Maßnahmen ohne Verständnis der jeweiligen politischen Prozesse keine Chance zur Umsetzung haben, sucht man hingegen vergeblich. Dies ist umso bedauerlicher, weil gerade in der Entwicklungsökonomik diese Sichtweise mehr und mehr an Bedeutung gewinnt und auch der Internationale Währungsfonds und die Weltbank sich diese Perspektive zu eigen gemacht haben (vgl. beispielsweise Cernea 2001, Lopez-Claros/Perotti 2014 und Stuart-Fox 2010). Im Kapitel über Arbeitsmarktökonomik (VKII, S. 141–193) führt Thomas Apolte zunächst auf 40 Seiten in den neoklassischen Ansatz der Arbeitsmarkttheorie ein, um dann die Funktionsweise von real existierenden Arbeitsmärkten mit all ihren Besonderheiten (gewerkschaftliche Lohnverhandlungen, Sozialpolitik, die zugrundeliegende rechtliche Ordnung) auf doch eher mageren drei Seiten abzuhandeln. Einerseits ist es natürlich erfreulich, dass diese Aspekte überhaupt Raum bekommen, andererseits hätte man sich gewünscht, dass diesen ordnungspolitischen Aspekten für diesen so wichtigen Bereich in modernen Marktwirtschaften etwas mehr Platz eingeräumt worden wäre.
Geordnete Finanzen? Fehlanzeige!
Aus Sicht der deutschen Tradition der Ordnungsökonomik (beziehungsweise der Freiburger Schule) besteht bei Charles B. Blankarts Buch „Öffentliche Finanzen in der Demokratie“ sicherlich ein gewisser ordnungspolitischer Nachholbedarf. Blankart argumentiert gekonnt vor dem Hintergrund der Neuen Politischen Ökonomie beziehungsweise der Public-Choice-Theorie, wie eine Vielzahl an Verweisen auf Autoren wie James M. Buchanan, Gordon Tullock, Mancur Olson, Bruno S. Frey, Dennis C. Mueller und Werner W. Pommerehne belegt. Explizite Verweise auf die Freiburger Schule finden sich jedoch nicht: Weder Franz Böhm noch Walter Eucken werden in dem mehr als 700 Seiten langen Werk erwähnt. Natürlich erwarten wir in einem Lehrbuch keine ordnungsökonomische Doxologie, jedoch ist die Frage des Ordnungsrahmens für das Verständnis und die Gestaltung öffentlicher Finanzen ebenso wichtig wie der Rückgriff auf politikökonomische Argumente.
Darüber hinaus kann das Staats- und Ordnungsverständnis von Blankart nicht immer überzeugen. So wird in Kapitel 3 (CB, S. 41–56) sehr abstrakt-theoretisch in „die ökonomische Logik des Staates“ eingeführt, die Bereitstellung eines adäquaten Rahmenwerkes zum Verständnis für politische Entscheidungen, wie man sie in der realen Welt vorfindet, sucht man an dieser Stelle vergeblich. Erst an späteren Stellen wird auf realweltliche Phänomene wie Machtkonstellationen, Koalitionsbildung und politische Abstimmungen eingegangen, die staatliches Handeln bedeutsam verändern können. Besonders schmerzlich vermisst man den Rekurs auf ordnungsökonomische Prinzipien in den Kapiteln 8 (CB, S. 141–155) und 9 (CB, S. 157–180); die Frage, wie groß ein Staat optimalerweise sein sollte und welche Dynamiken bewirken, dass das Staatswesen nicht selten über die vorher definierte Optimalgröße hinauswächst, wären als Kernanliegen der Ordnungsökonomik zu betrachten. Zwar geht Blankart detailliert auf monetäre und nicht-monetäre (sowie auf kurz- und langfristige) Kosten staatlicher Tätigkeit ein und stellt dann mehrere Wege vor, wie die Staatstätigkeit adäquat – bei Blankart bedeutet dies vor allem: quantitativ – gemessen werden kann. Hier werden dann jedoch vor allem die traditionellen Messmethoden wie die Erfassung des Nationaleinkommens als Wohlfahrts- und Leistungsmaß sowie die Staatsquote innerhalb der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorgestellt. Folglich bleibt der Aspekt der „Qualität“ der Staatstätigkeit außen vor. Aber nicht wie viel ein Staat macht, sondern was und vor allem wie er die an ihn gestellten Aufgaben erfüllt, sollte eigentlich von größerer Relevanz sein – Blankart klammert diesen Aspekt fast vollständig aus.
Auch hier wäre die Rückbesinnung auf Vertreter_innen der deutschen Ordnungsökonomik sicher hilfreich gewesen. So schreibt Walter Eucken in dem Vortragsband „Unser Zeitalter der Misserfolge“: „Ob wenig oder mehr Staatstätigkeit, diese Frage geht am Wesentlichen vorbei. Es handelt sich nicht um ein quantitatives, sondern um ein qualitatives Problem.“ (Eucken 1951, S. 72) Blankarts Darstellung von Theorien über das Staatswachstum und Methoden zu dessen effektiver Eindämmung ist umfassend und lesenswert, krankt aber daran, dass nicht in ausreichendem Maße erklärt wird, warum diese Beschränkung staatlicher Aktivität in manchen – real existierenden – Gesellschaften wesentlich besser funktioniert als in anderen. In diesem Zusammenhang klingt Blankarts Feststellung: „Sind die Bürger mit dem Umfang des Staates nicht mehr einverstanden, so müssen die Regeln geändert werden.“ (CB, S. 154) etwas seicht. Die Gestaltung der wirtschaftlichen Ordnung und von politischen Institutionen ist nicht allein das Ergebnis des Rationalkalküls aufgeklärter Bürger_innen eines Gemeinwesens, sondern auch das Ergebnis historischer Entwicklungspfade und ist rückgebunden an Normen, Werte und informelle Regelmechanismen „jenseits von Angebot und Nachfrage“ (Wilhelm Röpke).
Die Verwendung des Begriffs „Ordnung“ ist bei Blankart Mangelware. Am prominentesten tritt er in Verbindung mit dem Hayek’schen Präfix „spontan“ zutage (CB, S. 50–53), wobei dadurch vor allem die Wichtigkeit der Dezentralität von politischen Entscheidungen betont werden soll. Es ist bezeichnend, dass Blankart hier als das einzige „funktionierende“ Beispiel einer staatsähnlichen spontanen Ordnung die private Bewaffnung von Bewohner_innen der lybischen Stadt Benghazi angibt, die sich durch das Machtvakuum ergeben hatte, das aus dem Fall von Muamma al-Qaddhafis Regime resultierte. Ganz allgemein ist auffällig, dass Blankart kein allzu großer Freund von staatlichem Einfluss in das Wirtschaftsgeschehen ist – was per se nicht verwerflich und für Ökonom_innen auch nicht untypisch ist. Stellenweise treibt diese Staatskritik jedoch sonderbare Blüten, zum Beispiel wenn Blankart die wohlwollende Weber’sche Bürokratietheorie mit einem seitenlangen Zitat aus Franz Kafkas „Das Schloss“ zu diskreditieren versucht (CB, S. 538–539) oder feststellt, dass „wirtschaftliche Ausgrenzung und Protektionismus gegenüber Fremden wie selbstverständlich zu den souveränen Rechten des Nationalstaates“ (CB, S. 655) gehören und es enormer Anstrengungen bedarf, diese diskriminierenden und wirtschaftlich schädlichen Tendenzen einzudämmen.
Abschließender Befund
Globalisierung, Transformationsprozesse, massive Migrationsströme und eine bereits seit fast einem Jahrzehnt anhaltende Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise stellen die traditionellen Methoden, die Ökonom_innen zum Verständnis von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozessen anwenden, offensichtlich auf die Probe. Dennoch haben es alternative Ansätze wie das Denken in Ordnungen schwer. Wohl nicht wenige zeitgenössische Autor_innen wirtschaftswissenschaftlicher Fachliteratur lähmt möglicherweise die Befürchtung, sich mit Bezügen auf ordnungsökonomische Schriften, womöglich sogar aus dem vorherigen Jahrhundert, als „ewiggestrig“ zu disqualifizieren.
Entsprechend ist es zu würdigen, dass insbesondere die beiden zuerst angeführten Lehrbücher einen „wohlgeordneten“ Ordnungsbegriff verwenden und diesen durchaus gekonnt auf vergangene und aktuelle Tatsachen der sozialen Welt anwenden. Das Mitdenken von kulturellen und institutionellen Einflüssen auf die wirtschaftliche Entwicklung, eingebettet in einen breiteren sozialwissenschaftlichen Forschungskontext, ist in anderen Standardlehrbüchern üblicherweise gar nicht zu finden. Doch auch die vorliegenden Werke begrenzen die Ordnungsidee meist auf einzelne Passagen und Unterkapitel, während die sonstigen Teile (insbesondere bei Vahlens Kompendium und Blankart) dann wieder sehr stark der Darstellungs- und Ausdrucksweise der Mainstream-Ökonomik verpflichtet bleiben. Insgesamt zeigt die Durchsicht aber, dass es in der Ökonomik zukünftig noch stärker darum gehen muss, plurale Ansätze wie den ordnungsökonomischen auch in der Lehrbuchliteratur endlich ernst zu nehmen und diese vermehrt im Studium zum Einsatz kommen zu lassen.
Literatur
Arrow, K.J. (1950): A Difficulty in the Concept of Social Welfare. In: The Journal of Political Economy 58, Nr. 4, S. 328–346.
Cernea, M.M. (2001): Cultural heritage and development: a framework for action in the Middle East and North Africa, World Bank Group, Orientations in development series, Washington, DC.
Eucken, W. (1951): Unser Zeitalter der Misserfolge. Fünf Vorträge zur Wirtschaftspolitik, Tübingen: Mohr Siebeck.
Eucken, W. (1954 [1934]): Kapitaltheoretische Untersuchungen, 2. Auflage, Tübingen: Mohr Siebeck/Zürich: Polygraphischer Verlag.
Landemore, H. (2012): Democratic Reasons: Politics, Collective Intelligence, and the Rules of the Many, Princeton: Princeton University Press.
Lopez-Claros, A./Perotti, V. (2014): Does Culture matter for Development? World Bank Group, Policy Research Working Paper 7092, Washington, DC.
Goldschmidt, N. (2016): Gibt es eine ordoliberale Entwicklungsidee? Walter Euckens Analyse des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels. In: Kurz, H.D. (Hrsg.): Studien zur Entwicklung der ökonomischen Theorie XXXI, Schriften des Vereins für Socialpolitik, Band 115/XXXI, Berlin: Duncker & Humblot, S. 181–200.
Page, S.E. (2007): The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools and Societies, Princeton: Princeton University Press.
Stuart-Fox, M. (2010): Historical and Cultural Constraints on Development in the Mekong Region. In: Leung, S./Bingham, B./Davies, M. (Hrsg.): Globalization and Development in the Mekong Economies, Cheltenham: Edward Elgar.
[1] Das rechtlich-politische Rahmenwerk ist somit – neben anderen fünf Daten „Bedürfnisse“, Natur“, „Arbeit“, „technisches Wissen“ und „Konsumgütervorrat“ – lediglich ein, wenn auch ein wichtiges, Element des Eucken’schen Datenkranzes. Für eine detaillierte Diskussion des Datenkranzes vgl. Goldschmidt 2016, S. 192–194 und Eucken 1954[1934].
Gehe zu: Das Ordnungsverständnis in wirtschaftspolitischen und theoriegeschichtlichen Lehrbüchern