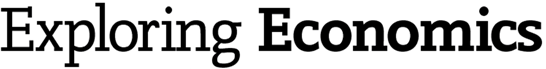Commons-Public Partnerships als Booster für die Transformation?

Foto von Boba Jaglicic auf Unsplash
Economists for Future, 2024
Erstveröffentlichung im Makronom am 18. November 2024
Weder Staaten allein noch Unternehmen werden angesichts des Klimakollaps‘ die Daseinsvorsorge und Infrastruktur aufrechterhalten. Neben der Fiskalwende braucht es dafür vor allem die Legitimation der Gemeingut kultivierenden Zivilgesellschaft.



![]()
Unsere Gesellschaft befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses. Im Zentrum: die Wirtschaft. Die nächsten Jahre werden entscheiden, ob uns der Wandel by disaster passiert oder uns by design gelingt. Die Debattenreihe Economists for Future (#econ4future) widmet sich den damit verbundenen ökonomischen Herausforderungen und diskutiert mögliche Lösungsansätze. Die mittlerweile sechste Staffel beleuchtet nun Aspekte rund um das Thema Überfluss.
Jährlich entstehen an deutscher Infrastruktur Milliardenschäden und -Investitionsbedarfe durch die Einhaltung der Schuldenbremse. Das Klimaschutzbudget ist quasi gestrichen und auch im Falle des kaum sichtbaren Willens der Industrienationen bräuchte es laut Weltklimarat erhebliche Mobilisierungen privaten Kapitals, um unsere Lebensgrundlagen auch nur ansatzweise zu erhalten. Große Zahlen schrecken dieser Tage von Klima und Infrastruktur ab. Dabei können sie auch schnell wieder klein aussehen: Die Jahresinstandhaltungskosten für Superyachten könnten den gesamten Globalen Süden entschulden, eine einstellige Vermögenssteuer innerhalb weniger Jahre die Bundesrepublik.
Katastrophenschutz und Kollapsvorsorge
Schaut man rein auf die verfügbare Arbeitskraft, waren während der Flutkatastrophe im Ahrtal mehrere zehntausend Helfende vor Ort, ohne die die Versorgung und das Auffangen nach dem Rückgang des Wassers sicher bedeutend unzureichender ausgefallen wäre. Und auch wenn dort extremistische Motive den fehlenden Modus Operandi zwischen Behörden und engagierter Zivilgesellschaft zum Teil ausnutzen konnten, wird an anderer Stelle bereits mit der Hinzuziehung versierter Freiwilliger als Hilfskräfte experimentiert (s. KatRetter, ZEUS).
Programme wie diese deuten an, dass „Partnerschaften mit zivilgesellschaftlichen Gruppen“ (Fraunhofer Innovation 2022) künftig unabdingbar für die auch nur annähernde Bewältigung von Krisen sein dürften. Dabei dürfen sich jedoch weder professionelles noch bürgerschaftliches Engagement auf die Bekämpfung von Symptomen wie Hochwassern beschränken, sondern muss die Bekämpfung der Ursachen und den veränderten Rahmen von Klima- und Biodiversitätskrise mit einbeziehen. Eine weitgehend vernachlässigte Kulturtechnik ist die Kultivierung des Teilens und das selbstorganisierte Verwalten von Gemeingütern (Commoning), das neue Bedürfnisse und Anforderungen unmittelbar erfassen, abwägen und berücksichtigen kann.
Ganz simpel: Was ist Commoning?
Ein Trekking-Rucksack ist oft teuer, sperrig und wird meist nur selten genutzt; ebenso die heimische Bohrmaschine. Und selbst wenn die zeitliche Überschneidung der Bedarfe berücksichtigt wird, können Carsharing-Genossenschaften vielfach mit etwas mehr als der Hälfte der sonst notwendigen Privat-Pkw die Mobilitätswünsche ihrer Mitglieder befriedigen. Wird derartiges Teilen von Gebrauchsgütern, Räumen oder anderen Ressourcen demokratisch organisiert und gepflegt, für noch Unbeteiligte zugänglich gemacht und werden die Aktivitäten gemeinschaftlich weiterentwickelt, verfällt in der Praxis vielfach die Notwendigkeit, die Dinge als Eigentum eines Einzelnen zu erfassen. In diesem Fall können wir vom Verwalten von Gemeingütern, Commoning (Gemeinschaffen), sprechen.
Damit ist Commoning nicht nur ein Mittel effizienter Nutzung von Ressourcen, sondern kann auch deren Verbrauch senken. Commoning-Praktiken folgen wiederkehrenden Mustern (vgl. Helfrich & Bollier 2019), finden sich weltweit und wurden über die Jahrhunderte immer wieder eingehegt, also unterdrückt und durch weniger nachhaltige, uns heute aber alltäglich erscheinende Formen des Privateigentums ersetzt. Ein demokratisch verfasster Staat berücksichtigt dagegen das kollektive Wohlergehen seiner Bürgerïnnen und schafft entsprechende Infrastruktur der öffentlichen Daseinsvorsorge. Daher kann es zwischen Commons-Vereinigungen, die in ähnlicher Weise Grundbedürfnisse erfüllen, und öffentlichen Institutionen zu fruchtbaren Überschneidungen kommen. Hier unterscheiden sich Commons-Vereinigungen, die nicht zwangsläufig eine offizielle Rechtsform besitzen, von herkömmlichen Interessenverbänden.
Kooperatives Wirtschaften trotz oder für den Staat?
Dennoch ist das Verhältnis von Staat und Commoners nicht unbedingt rosig: Zahlreiche gemeinwohlorientierte Initiativen, die gegenwärtig Commons kultivieren, sind angesichts der Streichung sozialer Rückversicherungen und der ökonomischen Entrechtung ihrer Mitglieder aus Notwendigkeit entstanden.
Dass sich jedoch ein moderner Staat ebenso wenig wie ein „kannibalistischer Kapitalismus“ (Fraser 2022) ohne ehrenamtliches Engagement und die unbezahlte Arbeit ganzer sozialer Gruppen erhalten kann, ist hinlänglich bekannt. Bezüglich der sozialökologischen Transformation gilt dies in Teilen etwa für folgende Beispiele:
- Solarcamps machen Laien innerhalb weniger Tage mit der Solarmontage vertraut – ein Handwerk, das über bisherige Betriebsgrößen den notwendigen Bedarf nicht decken
- Mit dem „Tegelwippen“ legalisieren Kommunen in Belgien und den Niederlanden das eigenständige Entsiegeln städtischer Flächen, wofür hierzulande selbst angesichts der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) hart gerungen werden muss.
- In nordamerikanischen Städten können Bürgerïnnen online und kostenfrei die Standorte neuer Straßenbäume bestimmen. Berlin-Brandenburger Vereine pflanzen Kleinstwälder auf öffentliche Brachen.
- In Nürtingen organisiert die Klima-Taskforce mit dem Dämm it!-Programm Hilfe beim Dämmen von Gebäuden.
- Community Land Trusts betten die Bereitstellung von Obdach und Wohnraum in den sozialen Kontext ein und beschließen dies gemeinsam mit Bewohnerïnnen und Nachbarschaft.
- Die Initiativen Deutsche Wohnen & Co.- und RWE enteignen haben anstelle plumper Verstaatlichung Konzepte für Anstalten des öffentlichen Rechts mit lokalen Abstimmungsgremien und Bewohnerïnnenversammlungen geschaffen.
- Sorgezentren-Initiativen setzen sich für die Nachnutzung leerstehender Einkaufszentren als multifunktionale Gemeinschaftszentren öffentlicher Infrastruktur ein, die die Nahversorgung in Form von durch SoLaWis versorgte Gemeinschaftsküchen, Pflegeangeboten und offenen Werkstätten sicherstellen wollen.
- Mit Mutual Aid Disaster Relief und dem American Climate Corps existieren zwei gegensätzliche, aber womöglich komplementäre Ansätze für Katastrophenvorsorge und Gefahrenabwehr.
Vorstöße wie diese dürfen keinesfalls weiter zur „Delegation der Leistungserbringung“ (van Dyk 2024) führen, die sorgendes und besorgtes Engagement als Argument für einen weiteren Rückzug des Sozialstaates nutzt, Aufwendungen an ebenso prekäre Ränder der Gesellschaft abwälzt und mit politischen Forderungen verbundenes Engagement sanktioniert. Vielmehr müssen an der Ausweitung der öffentlichen Daseinsvorsorge und der Zugänglichkeit geteilter Güter interessierte soziale Bewegungen und Zivilgesellschaft aktiv eingebunden, legitimiert und ihre enormen praktischen Fähigkeiten werden. In dieser Rolle vollführen öffentliche Einrichtungen ein „Insourcing“ (ebenda) lokaler Kapazitäten in Verwaltungen und schaffen lernende Institutionen zur „Expansion alternativökonomischer Formate“ (Heron et al. 2021 nach van Dyk 2024).
Perspektiven für die öffentliche Hand
Formalisierte Commons-Public Partnerships (CPP) gehen hier über die Stärkung der „Auftraggeberfähigkeit“ eines outsourcenden Staates hinaus, indem sie kollektive Rechte durch kollektive Infrastruktur verankern und vor Vereinnahmung durch autoritäre Kräfte und Partikularinteressen schützen können. In vielen Fällen könnten sie das in ihrer Wirtschaftlichkeit wie Transparenz fragwürdige Modell öffentlich-privater Partnerschaften ersetzen, indem sie im Bereich der nahweltlichen Grundversorgung den Zielkonflikt der Extraktion öffentlichen Wohlstands gewinnorientierter Unternehmen auflösen. Vielfach im Bereich des Wohnens und der Stadtentwicklung (Urban Commons) erdacht, wo sie unmittelbare Zugänglichkeit gewährleisten und Versorgungssicherheit unterstützen, können Commons-Public Partnerships auch in darüberhinausgehenden Kontexten implementiert werden. Forschende des Think-Tanks Abundance und andere heben die Übertragbarkeit auf Anwendungsfälle regionaler und überregionaler Tragweite (s.a. Jerchel & Pape 2022).
Damit CPPs gelingen, weisen Juristïnnen wiederholt auf Spielräume zur Selbstverwaltung (Wihl 2022), aber auch neue Rechtsformen (Neitzel 2022) und gar Ontologien abseits des Privat- und Öffentlichen Rechts hin (Schubel 2024). So könnte es zur Wahrung der Lebensgrundlagen und individueller Rechte Einzelner Kollektivrechte benötigen, die ihren Erhalt universell einfordern können.
CPPs als Teil eines Policy-Mix‘
Doch niedrigschwelliger können ein dediziert auf Commoning ausgelegter Policy-Mix und Institutionen zur Förderung gemeinschaffender Vorhaben beitragen (vgl. Jerchel 2023): In Neapel und anderen italienischen Gemeinden werden Gemeingüter wie Gebäudeensembles und Teile der Wasserversorgung durch Commons-Observatorien und -Versammlungen beaufsichtigt. Eine staatlich anerkannte Chamber of the Commons könnte als Pendant der Industrie- und Handelskammern gemeinschaftsgetragen wirtschaftende Unternehmungen repräsentieren. Eine Bundeskompetenzstelle könnte das notwendige Fachwissen zur Kooperation mit Commons-Vereinigungen in Ministerien und Behörden tragen. Eine regelmäßig fortschreibbare Commons-Strategie würde den Gesamtbestand kollektiven Wirtschaftens erstmalig erfassen und steuerbar machen. Commons Transition Plans können als prüfbare, öffentliche Vereinbarungen zur Vergesellschaftung privatisierter oder outgesourcter Teilbereiche staatlicher Fürsorge, Permanent Commons Funds als Finanzierungsoption für neue Commons-Vereinigungen dienen.
Politische Maßnahmen wie diese sollten mit einer Anpassung entsprechender Verwaltungsvorschriften einhergehen, um dem Verwaltungspersonal die Anbahnung entsprechender Kooperationen noch rechtssicherer zu ermöglichen. Ganz konkret könnten die oben genannten Beispiele für die sozialökologische Transformation in Commons-Public Partnerships überführt werden und als Föderation „transformativer Hilfswerke“ (Wans 2023) überregional vernetzt agieren, Ausbildungskapazitäten und technische Infrastruktur zu ‚Alarmierung‘ und Koordination teilen. Damit könnte dem in zahlreichen Gemeinden ausgerufenen „Klimanotstand“ durch den Aufwuchs lokaler und überregionaler Hilfskräfte entsprochen werden.
Commoning und Gemeinwesen – „oder Untergang“
Transformationspfade für weiteres regeneratives Wirtschaften wie Plattformkooperativen, Belegschaftserbe und glokale [sic!] Produktion durch verteiltes Design müssen an anderer Stelle diskutiert werden. Silke Helfrich bezeichnete jedoch die, zumindest perspektivisch als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge verfolgbare Perspektive, dass sich Personen in ihrem näheren Umfeld weniger durch anonyme Zahlungsbeziehungen als durch Commons und demokratisches Wirtschaften versorgen, als „unbedingtes Grundauskommen“.
Dabei kann die dekommodifizierte Befriedigung von Grundbedürfnissen, die lokal eingebettete Entscheidungsfindung („vertiefte Demokratie“) und die Rekultivierung von Gemeingütern viel zu einer Beschleunigung notwendigen Wandels beitragen, indem sie Kapazitäten für resiliente und zukunftsorientierte Gesellschaften freimachen. Denn feststeht: Vielerorts stellt sich die Frage nach einem Erhalt des Status Quo längst nicht mehr. Wenn wir die über die Notwendigkeiten des Lebens hinausgehenden Güter und Technologien erhalten und weiterentwickeln wollen, müssen wir ihre Zugänglichkeit als „öffentlichen Luxus“ sicherstellen – oder wir werden sie verlieren. Ohne Umverteilung, Organisation und die rechtliche, politische und administrative Aufmerksamkeit ist vom Versprechen annähernd gleicher Freiheiten und Rechte kaum mehr etwas zu erhalten.
Wer keine kollabierende Welt miterleben möchte, in denen ein abgeschmolzenes und handlungsunfähiges Gemeinwesen von neofeudalen Inseln der Glückseligkeit Einzelner (vgl. Kemper 2022, Slobodian 2023, Rushkoff 2023) durchzogen wird und dessen dürre Grundversorgung immer wieder spontan vom Einsturz einer Brücke oder Unterbrechungen von Wasserversorgung und Kommunikationswegen versagt, möge die entscheidenden Schritte erwägen. Es gilt, den Überfluss an Beziehungen und gutem Leben durch neue Partnerschaften für dauerhaften Zugang und Teilhabe an Ressourcen hier und jetzt zu ermöglichen. Commons-Public Partnerships können das allein nicht verwirklichen, aber sie sind ein wichtiges Framework, indem es sich zu denken lohnt.
Zum Autor:
Paul Jerchel studierte Politik und VWL und begann anschließend ein Ingenieurstudium. Er arbeitete in der Mikroelektronik- und Nachhaltigkeitsforschung, sowie in der Beteiligungs- und Wissenschaftspolitik. Zu Commons-Public Partnerships erschien von ihm ein Diskussionspapier (RIFS Potsdam 2021). Er ist Mitglied der Open-Hardware-Allianz (OHA) und des INDEP.