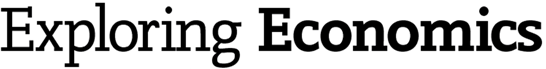Wie der Kredit wirklich in die Welt kommt
Wirtschaft neu denken: Blinde Flecken in der Lehrbuchökonomie, 2016
Wie der Kredit wirklich in die Welt kommt
… und was die Standardlehrwerke der Volkswirtschaftslehre alles falsch machen
Fabian Lindner
Quelle: van Treeck, Till, and Janina Urban. Wirtschaft neu denken: Blinde Flecken in der Lehrbuchökonomie. iRights Media, 2016. Das Buch kann hier bestellt werden: http://irights-media.de/publikationen/wirtschaft-neu-denken/.
Rezensierte Bücher:
Mankiw, N.G./Taylor, M.P. (2012): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 5. Auflage, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1133 Seiten. Im Folgenden zitiert als MT. (Abb: Schäffer-Poeschel)
Krugman, P./Wells, R. (2010): Volkswirtschaftslehre, Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1166 Seiten. Im Folgenden zitiert als KW. (Abb: Schäffer-Poeschel)
Jede Finanzkrise ist in erster Linie eine Schuldenkrise. Schuldner_innen nehmen zu viele Kredite auf, die sie dann nicht mehr bedienen können. Gläubiger_innen – vor allem Banken – müssen in der Folge ihre Forderungen abschreiben und vergeben weniger Kredite. Die Finanzkrise ist da.
Um eine solche Finanzkrise wirklich zu verstehen, muss man aber erst begreifen, wie Kredite eigentlich entstehen und wie genau Banken und andere Finanzinstitutionen funktionieren. Aufgabe einführender Bücher in die Volkswirtschaftslehre sollte sein, diese fundamentalen Zusammenhänge darzustellen. Leider stellen diese Bücher das Finanzsystem und die Kreditschöpfung meist falsch dar. Das erschwert sowohl die Analyse einer Finanzkrise als auch Wege zu ihrer Lösung zu finden.
Es gibt in führenden Lehrbüchern viele falsche Vorstellungen über den Kredit (siehe dazu beispielsweise Werner 2014 und S&P 2013). Hier soll der Fokus auf die Theorie der „ausleihbaren Mittel“ gelegt werden, im Englischen als „Loanable funds“- Theorie bezeichnet. Nach dieser Theorie sei der Kredit durch die Haushaltsersparnis limitiert und die Haushalte müssten auf Konsum verzichten, damit Unternehmen Kredite erhalten. Aus diesem Grund gebe es auch eine Konkurrenz um Kredite. Würde etwa der Staat Kredite zur Defizitfinanzierung aufnehmen, so würde er diese Kredite den Unternehmen abspenstig machen und somit deren Investitionstätigkeit verringern. Im Folgenden wird diese Theorie dargestellt, wie sie sich etwa in den Lehrbüchern von Mankiw und Taylor (2012) und von Krugman und Wells (2010) findet. Darauf wird sie anhand einfacher Buchhaltungsregeln kritisiert (ausführlicher dazu Lindner 2015).
Theorie der ausleihbaren Mittel
Nach der „Theorie der ausleihbaren Mittel“ ist das Kreditangebot in einer Periode durch die Haushaltsersparnis derselben Periode beschränkt. Das hat zwei Implikationen: Erstens erhöhe Konsumverzicht das Kreditangebot und zweitens gebe es Konkurrenz um die knappe Ersparnis. Um das zu zeigen, leiten Mankiw/Taylor und Krugman/Wells folgende Gleichung ab (Details in MT, S. 689–690 und bei KW, S. 815–816):
(1) S = (Y–T–C) + (T–G) = I
Die Ersparnis S ist die Summe aus privater Ersparnis (das Einkommen Y, von dem Steuern T und Konsum C abgezogen werden) und öffentlicher Ersparnis (Steuern T, von denen Staatsausgaben G abgezogen werden). I sind die Investitionen. Die Gesamtersparnis ist dann gleich den Investitionen, also
(2) S = I
Nun wird Gleichung (1) so interpretiert (MT, S. 692): „Das Angebot an Mitteln stammt von denjenigen Menschen, die einen (derzeit überzähligen) Teil ihres Einkommens sparen und verleihen wollen. […] Ersparnis [ist] die Quelle des Angebots an Kreditmitteln. Die Nachfrage nach Kreditmitteln stammt von Haushalten und Unternehmungen, die Mittel aufnehmen möchten, um Investitionen [Hauskauf oder neue Maschinen] durchzuführen. […] Investitionen [sind] die Quelle der Nachfrage nach Kreditmitteln.“
Der Gleichgewichtszins auf dem Kreditmarkt werde dann beim Schnittpunkt einer im Zins steigenden Sparkurve (= Kreditangebotskurve) und einer im Zins fallenden Investitionskurve (= Kreditnachfragekurve) bestimmt. Entscheiden nun die Haushalte, beim gleichen Zins weniger zu konsumieren, würden sie damit die verfügbare Sparsumme erhöhen, die Sparkurve/Kreditangebotskurve würde sich nach rechts verschieben und der Zins würde sinken (KW, S. 825; MT, S. 696).
Würde nun der Staat Budgetdefizite realisieren, muss er diese finanzieren. Zur Finanzierung sei er auf die Haushaltsersparnis angewiesen. Mit dem Budgetdefizit verknappe er aber – da er entspart – das Sparangebot für die Unternehmen. Mankiw und Taylor dazu (S. 698): „[W]enn die Regierung Mittel aufnimmt, um das Budgetdefizit zu finanzieren, so reduziert sie damit das Angebot an Kreditmitteln, die den Haushalten und Unternehmungen zur Finanzierung ihrer Investitionsvorhaben zur Verfügung stehen.“ Der Staat würde den Unternehmen also die Kredite wegnehmen und es bestünde eine Konkurrenz um die knappen „ausleihbaren Mittel“. Krugman und Wells machen das gleiche Argument (KW, S. 824).
Im Folgenden soll nun gezeigt werden, dass die Kreditvergabe in der Realität niemals durch Ersparnis und Konsumverzicht limitiert ist und die Regierung den Unternehmen auch keine Kredite abspenstig macht. Vielmehr gilt meistens das genaue Gegenteil dessen, was die Loanable-funds-Theorie und ihre Vertreter_innen glauben: Eine höhere Ersparnis der Haushalte und des Staates führt tendenziell dazu, dass die Mittel für Unternehmen knapper und nicht reichlicher werden und die Investitionen eher fallen als steigen. Das hat wesentlich damit zu tun, dass die Vertreter_innen dieser Theorie nicht zwischen den vollständig unterschiedlichen Konzepten „Sparen“ und „Kreditvergabe“ unterscheiden.
Kreditvergabe vs. Sparen
Eine Wirtschaftseinheit spart (S), wenn sie weniger als ihr Einkommen (Y) konsumiert (C):
(3) S = Y–C
Durch Sparen erhöhen Sparer_innen ihr Reinvermögen (RV) (siehe dazu Stobbe 1994). Das Reinvermögen (bei Unternehmen auch das Eigenkapital genannt) ist die Summe aus dem Sachvermögen (Häuser, Maschinen etc.), den Geldforderungen (Kredite, Anleihen, Geld) abzüglich der Verbindlichkeiten (Geldschulden):
(4) RV = Sachvermögen + Geldforderungen – Verbindlichkeiten
(5) Y–C = ∆RV = ∆Sachvermögen + ∆Geldforderungen – ∆Verbindlichkeiten
Bei der Kreditvergabe verändert aber niemand sein Reinvermögen (mehr zum Sparkonzept findet sich bei Schmidt 2012). Die Kreditvergabe ist eine reine Finanztransaktion. Das sind Transaktionen, die gerade nicht zu einer Reinvermögensveränderung, also Sparen, führen (Stobbe 1994, S. 100).
Das soll zuerst anhand der Kreditvergabe einer Bank gezeigt werden. Vergibt eine Bank einen Kredit, so erhöht sie im gleichen Schritt sowohl ihre Geldforderungen – die Kreditforderung gegenüber der Kreditnehmerin – als auch ihre Verbindlichkeiten. Ihre Schulden erhöht sie, weil sie der Kreditnehmerin Giralgeld auf ihrem Konto gutschreibt. Dieses Giralgeld ist eine Schuld der Bank und eine Forderung der Kreditnehmerin gegenüber der Bank.
Mit diesem Akt wird Geld – genauer: Giralgeld – neu geschaffen, das es vorher nicht gab (Deutsche Bundesbank 2015, S. 76; McLeay et al. 2014, S. 3 ff.). Die Bank schafft so Geld „aus dem Nichts“. Weil sich die Geldforderungen und Schulden um den gleichen Betrag erhöht haben, hat sich das Reinvermögen der Bank nicht verändert (Tabelle 1 links). Es ist also von niemandem gespart worden und es hat niemand seinen Konsum für die Kreditvergabe einschränken müssen – und doch ist ein neuer Kredit geschaffen worden.
Auch die Kreditnehmerin verlängert ihre Bilanz: Sie hat höhere Forderungen – das ist der höhere Kontostand bei der Bank – und sie hat höhere Schulden – also ihr Kredit von der Bank (Tabelle 1 rechts). Das Nettogeldvermögen der Kreditnehmerin hat sich nicht verändert, so dass sie ihr Reinvermögen nicht verändert und ergo nicht ge- oder entspart hat.
Tabelle 1: Kreditvergabe aus Sicht der Bank (links) und aus Sicht der Kreditnehmerin (rechts)
| Bank |
Kreditnehmerin |
|||
| ∆ Aktiva | ∆ Passiva | ∆ Aktiva | ∆ Passiva | |
| + ∆ Kredit | + ∆ Schulden | + ∆ Geldbestand | + ∆ Kreditschulden | |
Auch Wirtschaftseinheiten, deren Schulden nicht wie die von Banken als Geld akzeptiert werden, können Kredite vergeben. Zu diesen Wirtschaftseinheiten gehören etwa Fonds oder Versicherungen, die im Gegensatz zu Banken tatsächlich reine Finanzintermediäre sind, da sie alles Geld, das sie verleihen, vorher erst mal selbst ausleihen (oder verdienen) müssen. Wer kein Geld schaffen kann und einen Kredit vergibt, tauscht sein vorhandenes Geld gegen eine Kreditforderung (Tabelle 2). Dies nennt man einen „Aktivtausch“. Damit ändert sich zwar die Zusammensetzung des Geldvermögens, aber wieder nicht die Höhe des Reinvermögens:
(6) ∆Kredit – ∆Geld = ∆RV = 0
Die Kreditnehmerin verlängert wiederum wie in Tabelle 1 (rechts) ihre Bilanz, weil sie sowohl ihren Geldbestand als auch ihre Schulden erhöht.
Tabelle 2: Kreditvergabe ohne Geldschaffung
| ∆Aktiva | ∆Passiva |
|
– ∆ Geldbestand + ∆ Kreditforderungen |
Hier ist wichtig festzustellen, dass die Loanable-funds-Theorie auch dann nicht richtig wäre, wenn die Geschäftsbanken keine Kredite vergeben würden, sondern nur reine Finanzintermediäre dies täten: Das Geld, das diese Finanzintermediäre verleihen, kommt in letzter Instanz von der Zentralbank (sogenanntes Zentralbankgeld, das aus Bargeld und Einlagen bei der Zentralbank besteht). An Zentralbankgeld kommen Nichtbanken aber nur über das Bankensystem. Denn es sind die Banken, die sich das Zentralbankgeld ohne irgendeine Ersparnis per Kredit bei der Zentralbank leihen (der Vorgang in Tabelle 1 gilt genauso, wenn sich eine Geschäftsbank bei der Zentralbank Geld leiht) und es dann den Nichtbanken zur Verfügung stellen.
Eine Privatperson oder ein Unternehmen kann also erst Bargeld bei einer Bank als Einlage einzahlen oder einem reinen Finanzintermediär zum Weiterverleihen zur Verfügung stellen, wenn sie es vorher bei einer anderen Bank abgehoben hat. Aber auch dieses Abheben und Einzahlen von Bargeld hat nichts mit Sparen zu tun, denn das Reinvermögen der an diesen Transaktionen beteiligten Wirtschaftseinheiten verändert sich nicht.
Man sieht also, dass es nicht des Sparens bedarf, damit ein Kredit angeboten werden kann. Ebenso wenig hat sich jemand im Konsum einschränken müssen. Die Idee, Sparen sei gleich dem Kreditangebot, ist schlicht vollkommen falsch.
Dass Banken Giralgeld „aus dem Nichts“ schaffen können, bedeutet aber nicht, dass die Kreditvergabe vollkommen unbeschränkt ist. Giralgeld ist eine Forderung auf Zentralbankgeld. Das heißt, wenn eine Bank neues Giralgeld per Kredit schafft, muss sie in der Lage sein, es bei Bedarf in Zentralbankgeld umzutauschen. Und Zentralbankgeld kann eine Geschäftsbank per Definition nicht selbst herstellen, denn das kann nur – wie der Name schon sagt – die Zentralbank.
Eine Geschäftsbank braucht Zentralbankgeld, wenn jemand sein Geld bar von der Bank abhebt und – wichtiger noch – wenn jemand sein Giralgeld auf ein Konto einer anderen Bank überweist. Banken akzeptieren nämlich in der Regel untereinander nur Zentralbankgeld, nicht das jeweilige Giralgeld anderer Banken. Will also eine Kundin ihr Giralgeld von Bank A auf ein Konto bei Bank B überweisen, muss Bank A der Bank B Zentralbankgeld auf ihr Konto bei der Zentralbank überweisen (Geschäftsbanken halten in der Regel Konten bei der Zentralbank). Wenn Bank A kein Zentralbankgeld hat, kann sie es von anderen Banken über den Interbankenmarkt oder von der Zentralbank leihen. Hat sie kein Zentralbankgeld und kann sich auch keines leihen, kann sie die Zahlung nicht durchführen und ist somit zahlungsunfähig und muss Insolvenz anmelden. Ist das bei vielen Banken der Fall, tritt eine Finanzkrise ein. Banken sind also in ihrer Giralgeldschöpfung durch die Verfügbarkeit von Zentralbankgeld beschränkt.
Eine zweite Einschränkung für die Kredit- und Geldschöpfung aus dem Nichts ist die Solvenz der Gläubiger_innen. Kann eine Gläubigerin ihren Kredit nicht mehr bedienen, muss die Bank den Kredit abschreiben. Das vermindert den Wert ihrer Aktiva und damit ihres Eigenkapitals. Ist das Eigenkapital durch zu viele ausfallende Kredite bei null oder sogar negativ, so muss die Bank wiederum Insolvenz anmelden. In einer Rezession geraten meist viele Gläubiger_innen in Zahlungsschwierigkeiten, was das Eigenkapital und damit die Solvenz der Banken reduziert.
Drittens beschränkt das regulatorisch notwendige Eigenkapital die Kreditvergabe. Die Bankenregulierung schreibt ein bestimmtes notwendiges Eigenkapital vor. Banken müssen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Aktiva als Eigenkapital halten, die Eigenkapitalquote. Wollen sie ihre Kreditvergabe etwa durch eine Bilanzverlängerung ausweiten, müssen sie zusätzlich ihr Eigenkapital erhöhen. Das kann etwa durch die Ausgabe von Aktien erfolgen. Kann die Bank ihr Eigenkapital nicht erhöhen, etwa, weil niemand ihre Aktien kaufen will, kann sie auch keine zusätzlichen Kredite vergeben.
Sparen, Finanzieren und Investieren im einfachen Beispiel
Was würde aber passieren, wenn die Wirtschafter_innen – Unternehmen, Haushalte, Staat – im Sinne der Loanable-funds-Theorie handeln würden, also mehr sparen würden, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Kredite angeboten werden? Im Folgenden wollen wir zeigen, dass sich mit hoher Wahrscheinlichkeit die genau gegenteiligen Ergebnisse einstellen werden als von der Loanable-funds-Theorie prognostiziert: Bei höherer Ersparnis der Haushalte und der Regierung werden die Investitionen der Unternehmen eher fallen und die Zinsen eher steigen. Darüber hinaus kann man zeigen, dass Kredite oft eher eine Voraussetzung für das Sparen sind – nicht die Folge von Sparen. Dazu muss man als erstes genauer zeigen, wie sich das Einkommen der einzelnen Sektoren zusammensetzt und wie speziell sich die Umsätze und die Gewinne der Unternehmen ergeben.
Nehmen wir der Einfachhalt halber eine geschlossene Wirtschaft an, in der es Unternehmen, Haushalte, Banken und einen Staat gibt. Die Unternehmen produzieren Konsum- und Investitionsgüter, stellen Arbeitnehmer_innen ein und zahlen Löhne. Die Haushalte kaufen Konsumgüter und bieten ihre Arbeitskraft gegen Lohn an. Der Staat bietet öffentliche Leistungen an, stellt öffentliche Bedienstete ein, investiert in die öffentliche Infrastruktur und erhebt Steuern. Das verfügbare Einkommen der Haushalte kann dann so geschrieben werden:
(7) yh = c + Löhneu+st + Zinsenh + tr – th – cAusgabe
Die Ausgaben für den Konsum sind cAusgabe; der Konsum selbst ist c; die Haushalte empfangen Löhne von den Unternehmen u und als öffentliche Angestellte oder Beamte vom Staat st; sie erhalten Zinsenh durch ihre Bankguthaben; sie erhalten Transfers vom Staat tr (Renten, Kindergeld, Arbeitslosengeld etc.) und zahlen Steuern th.
Zu beachten ist, dass der Konsum doppelt gezählt wird: Der Kauf der Konsumgüter ist eine Ausgabe, die vom Einkommen abgezogen wird. Aber auch der Konsum muss positiv gezählt werden, sonst wäre das Einkommen immer nur so hoch wie die Löhne und Nettotransfers abzüglich der Konsumausgaben (bei positiven Konsumausgaben also immer kleiner als die Löhne und Nettotransfers). Der Konsum wird ebenfalls positiv gezählt, weil es sein kann, dass Haushalte ihre Konsumgüter selbst produzieren und keine Konsumgüter kaufen. Da auch Produktion Einkommen ist, würden selbst produzierte Konsumgüter das Einkommen erhöhen.
Das verfügbare Einkommen der Unternehmen (das per Definition gleich ihrem Gewinn ist) kann man so schreiben:
(8) yu = π = iu + cEinnahme + ist,Einnahme – tu – Löhneu – Zinsenu
Dabei ist cEinnahme + ist,Einnahme der Umsatz der Unternehmen, denn sie stellen Konsumgüter für die Haushalte sowie Investitionsgüter für den Staat her – die öffentliche Infrastruktur. tu sind die von den Unternehmen zu zahlenden Steuern. Die Herstellung der Investitionsgüter iu , die die Unternehmen für die eigene Produktion brauchen, erhöht direkt das Einkommen und den Gewinn der Unternehmen, weil es ihr Ertrag ist (auch wenn es keine Ausgabe für den Unternehmenssektor ist).
Das Einkommen des Staates ist:
(9) yst = cst + ist + tu+h – tr – Löhnest – ist,Ausgabe – Zinsenst
Wieder werden Konsum (gleich den gezahlten Löhnen für die bereitgestellten öffentlichen Dienste, die in der offiziellen Statistik als Staatskonsum verbucht werden) und Investitionen wie bei den Haushalten und den Unternehmen positiv gerechnet, die entsprechenden Ausgaben negativ. tu+h sind die von den Unternehmen und Haushalten erhaltenen Steuern und tr die an die Haushalte gezahlten Transfers.
Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass die Banken keinen Gewinn machen, sondern ihre Zinseinnahmen (von den Unternehmen und vom Staat für vorher vergebene Kredite) gleich ihren Zinsausgaben (für die Bankguthaben der Haushalte) sind:
(10) Zinsenu+st = Zinsenh
Aus den Einkommensgleichungen ist leicht ersichtlich, dass jeder Einnahme eine Ausgabe entspricht: Die Lohneinnahmen der Haushalte sind die Lohnausgaben des Staates und der Unternehmen; die Konsumausgaben der Haushalte sind die Einnahmen aus dem Konsumgüterverkauf der Unternehmen; die von Unternehmen und Haushalten gezahlten Steuern sind die Einnahmen des Staates etc. Zieht man dann alle Einnahmen von allen Ausgaben ab, ergibt sich als Summe null:
(11) Löhneu+st – Löhneu – Löhnest + tr – tr + tu + h – th – tu + cEinnahme – cAusgabe + ist,Einnahme – ist,Ausgabe + Zinsenu+st – Zinsenh = 0
Diese Gleichung kann man nach den Einnahmen und den Ausgaben der Unternehmen umstellen und dann in die Gewinngleichung der Unternehmen (Gleichung 8) einsetzen:
(12) yu = π = iu – (Löhneu+st + Zinsenh + tr – th – cAusgabe ) – (tu + h – tr – Löhnest – ist,Ausgabe – Zinsenst )
Somit erhält man die Gewinngleichung der Unternehmen in Abhängigkeit von den Einnahme-Ausgabe-Salden der Haushalte und des Staates, also deren Sparen. In der ersten Klammer ist das Sparen der Haushalte abgebildet (ihr verfügbares Einkommen abzüglich ihrer Konsumausgaben); in der zweiten Klammer ist das Sparen des Staates angegeben (seine Steuereinnahmen abzüglich der Transfer-, Lohn-, Investitions-, und Zinsausgaben).
Hier zeigt sich nun, dass die Unternehmensgewinne negativ von der Ersparnis der Haushalte und des Staates abhängen: Je weniger die Haushalte von ihrem verfügbaren Einkommen ausgeben, desto geringer sind – bei gegebenen Investitionen – die Gewinne. Das Gleiche gilt für den Staat: Senkt dieser sein Defizit oder realisiert sogar einen Überschuss, sinken die Gewinne der Unternehmen. Das ist auch ganz logisch: Konsumausgaben der Haushalte und die staatlichen Investitionsausgaben sind die Umsätze der Unternehmen; wenn der Staat seine Transfer- oder Lohnzahlungen senkt, verringert sich das verfügbare Einkommen der Haushalte, so dass diese weniger Geld für den Konsum haben etc. Diesen wichtigen Zusammenhang blendet die Loanable-funds-Theorie einfach aus.
Was würde nun geschehen, wenn die Haushalte und die Regierung plötzlich mehr sparen würden? Ihr höheres Sparen führt erst mal nicht zur Kreditaufnahme, sondern zu einer Verringerung der Unternehmensumsätze und – wenn die Unternehmen ihre Ausgaben für Löhne, Steuern und Zinsen nicht verändern – auch zu einer Verringerung ihrer Gewinne. Das Sparen der übrigen Wirtschaft entzieht also den Unternehmen Mittel.
Umgekehrt gilt: Würden die Haushalte und der Staat entsparen – also mehr ausgeben als einnehmen – hätten die Unternehmen mehr Geld zur Verfügung, das sie etwa für Investitionen ausgeben könnten. Das sind nun aber die genau entgegengesetzten Schlussfolgerungen, als sie die Loanable Funds-Theorie zieht.
Aus diesen Zusammenhängen lässt sich folgern, was die Unternehmen wahrscheinlich machen würden, wenn Haushalte und Regierung plötzlich mehr sparen: Sie würden als erstes mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger investieren, da sie ja mehr produziert als verkauft haben, also sich das Produzieren weniger lohnt. Wenn die vorhandenen Anlagen schon nicht voll ausgelastet sind, wäre die Anschaffung neuer Anlagen – die Investition – höchst irrational.
Die Unternehmen werden auch aus finanziellen Erwägungen weniger investieren, denn durch das höhere Sparen des Rests der Wirtschaft steigt ihr Insolvenzrisiko. Sie haben durch die Ausgabenzurückhaltung von Haushalten und Staat weniger Umsätze aus dem Verkauf von Konsum- und Investitionsgütern (cEinnahme + ist,Einnahme ). Aus diesen Umsätzen müssen sie aber ihren vertraglich fixierten Zinsdienst (Zinsenu) leisten. Je geringer die Differenz zwischen Umsätzen und Zinsdienst, desto wahrscheinlicher müssen die Unternehmen Zahlungsunfähigkeit – also Insolvenz – anmelden. Da sich das Insolvenzrisiko erhöht, werden die Zinsen tendenziell eher steigen. Denn die Zinsen reflektieren auch das Risiko von Schuldner_innen. Das ist aber genau das Gegenteil dessen, was die Loanable-funds-Theoretiker_innen behaupten.
Das heißt, aus zwei Gründen hängen die Investitionen tendenziell eher negativ von der Ersparnis der Haushalte und der Regierung ab: Durch das Sparen der Haushalte und des Staates werden erstens schon vorhandene Anlagen weniger ausgelastet und zweitens nimmt das Insolvenzrisiko der Unternehmen zu.
Noch ein Sachverhalt ist in der Tendenz eher genau umgekehrt als von der Loanable-funds-Theorie angenommen: Der Kredit ist nämlich eher die Voraussetzung für das Sparen als umgekehrt. Wenn die Unternehmen etwa einen Kredit aufnehmen und davon Arbeitnehmer_innen einstellen und Löhne zahlen, hängt das Einkommen der Haushalte vom Kredit ab. Aber erst wenn sie über Einkommen verfügen, können sie darüber entscheiden, wie viel sie davon für Konsumgüter ausgeben und wie viel sie sparen wollen. Das Sparen ist dann eine Folge der Kreditaufnahme.
Das Gleiche gilt für den Staat: Wenn dieser einen Kredit aufnimmt, um Menschen für den öffentlichen Dienst einzustellen oder öffentliche Investitionen zu finanzieren, entstehen den Haushalten und den Unternehmen Einkommen, die diese wieder ausgeben oder sparen können. Auch hier wäre der Kredit Voraussetzung für das Sparen, nicht dessen Folge.
Zusammenfassend kann man sagen, dass in der realen Welt tendenziell die genau umgekehrten Schlussfolgerungen als diejenigen der Loanable-funds-Theorie zu ziehen sind:
-
Die Konsumzurückhaltung der Haushalte ist keine Voraussetzung für neuen Kredit, denn die Banken schöpfen den Kredit „aus dem Nichts“. Selbst wenn die Banken das nicht tun würden, sondern reine Finanzintermediäre wären, bräuchte es keine Konsumzurückhaltung.
-
Eine zu starke Konsumzurückhaltung der Haushalte und des Staates führt nicht zu mehr Mitteln für die Unternehmen, sondern über die sinkenden Umsätze eher zu weniger Mitteln. So erhöht die Ersparnis von Haushalten und Staat das Insolvenzrisiko der Unternehmen, da diese einen geringeren Cashflow haben, aus dem sie ihren Schuldendienst leisten können.
-
Die Investitionen werden bei Konsumzurückhaltung und staatlichem Sparen tendenziell niedriger ausfallen, da es keinen Anreiz für höhere Investitionen gibt, wenn schon vorhandene Kapazitäten unterausgelastet sind.
-
Wenn Kreditnehmer_innen aus ihren Krediten Ausgaben finanzieren, entstehen dem Rest der Wirtschaft Einkommen, aus denen dann gespart werden kann. Der Kredit ist also eher die Voraussetzung als die Folge von Ersparnis.
Warum begeht die Loanable-funds-Theorie diese Fehler?
Wie kann es sein, dass in so vielen Lehrbüchern eine solch falsche Theorie dargestellt wird? Hier wird gezeigt, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit daran liegt, dass die meisten Ökonom_innen noch immer einem Modell anhängen, das versucht, auf Grundlage einer agrarischen Eingüterwirtschaft Schlussfolgerungen über die moderne Geldwirtschaft zu ziehen.
Eines der Basismodelle vieler der bis heute gängigen Modelle ist das Modell der überlappenden Generationen von Peter Diamond (1965). Diamond entwirft darin eine Wirtschaft, in der es zwei Generationen gibt – Junge und Alte – sowie einen Unternehmenssektor, der nur ein Gut produziert. Es herrscht per Annahme Vollbeschäftigung. In dieser Wirtschaft wird nicht mit Geld gezahlt, sondern mit dem Gut, das die Unternehmen mithilfe der jungen Generation – den Arbeitnehmer_innen – produzieren.
Am besten können die Modellzusammenhänge veranschaulicht werden, wenn man sich das Gut als Weizen vorstellt (siehe dazu Stiglitz/Greenwald 2003). Die Unternehmen verteilen ihre Weizenernte als Löhne an die Arbeiter_innen (die Jungen) und als Zinsen an die alte Generation. Die Alten konsumieren ihren gesamten Weizen (ihre Rente). Die Jungen können sich entscheiden, wie viel ihres Weizens sie essen (konsumieren) oder den Unternehmen für einen Zins ausleihen (ihre Ersparnis). Da die Unternehmen die ganze Ernte schon verteilt haben, brauchen sie für den Anbau neuen Weizens für die nächste Periode Weizenkerne von den Haushalten, damit sie diese säen – also investieren – können.
Hier sieht man schnell, dass es eine direkte Konkurrenz um den Weizen gibt: Wenn die Alten und die Jungen ihn vollkommen aufessen, also konsumieren, können die Unternehmen nicht säen und investieren. Neuen Weizen kann man in einer Periode nicht herstellen, da ja wegen Vollbeschäftigung schon alle Ressourcen für Ernte und Anbau des Weizens eingesetzt worden sind. Die Konsumzurückhaltung der Jungen ist dann also notwendig für ihre Kreditvergabe und damit für die Unternehmensinvestitionen. Hier sind also tatsächlich – wie von der Loanable-funds-Theorie angenommen – Kreditangebot, Ersparnis und Investitionsnachfrage identisch, und es kann nur dann investiert werden, wenn vorher gespart wurde.
Das liegt aber daran, dass alle Probleme der modernen Geldwirtschaft wegdefiniert wurden: Die Jungen und Alten erhalten die Ernte, aber sie erhalten kein Geld, mit dem sie Weizen kaufen oder auch nicht kaufen können. Dementsprechend gibt es keine Absatzprobleme der Unternehmen, denn sie verkaufen ihren Weizen ja gar nicht, sondern verteilen ihn gleich nach der Ernte. Und da Weizen sowohl Zahlungsmittel, Konsumgut als auch Investitionsgut ist, gibt es eine direkte Konkurrenz um ihn (siehe den Beitrag von Hansjörg Herr in diesem Band). Die gäbe es mit Geld nicht, weil man Geld weder essen noch pflanzen kann und es auch nicht wie Weizen irgendwann schlecht wird.
Das Modell von Diamond – und damit auch die darauf aufbauenden neoklassischen Modelle – lassen sich sehr gut für die Analyse von mittelalterlichen Agrarwirtschaften anwenden. Wendet man sie aber in der Form der Loanable-funds-Theorie auf die moderne Geldwirtschaft an, gerät man auf den Holzweg.
Literatur
Deutsche Bundesbank (2015): Geld und Geldpolitik, Frankfurt, https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Schule_und_Bildung/geld_und_geldpolitik.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff: 19. Sept. 2016).
Diamond, P.A. (1965): National Debt in a Neoclassical Growth Model. In: The American Economic Review 55, Nr. 5, S. 1126–1150.
McLeay, M. et al. (2014): Money Creation in the Modern Economy. In: Bank of England Quarterly Bulletin, 1. Quartal, S. 1–14.
Lindner, F. (2015): Does Saving Increase the Supply of Credit? A Critique of Loanable Funds Theory. In: World Economic Review 4, S. 1–26.
Schmidt, J. (2012): Sparen – Fluch oder Segen? Anmerkungen zu einem alten Problem aus Sicht der Saldenmechanik. In: Held, M./Kubon-Gilke, G./Sturn, R. (Hrsg.): Normative und institutionelle Grundfragen der Ökonome, Marburg: Metropolis, S. 61–86.
Stobbe, A. (1994): Volkswirtschaftliches Rechnungswesen, 8. Auflage, Berlin: Springer.
Standard & Poor’s (2013): Repeat After Me: Banks Cannot And Do Not „Lend Out“ Reserves, S&P Economic Research, 13.08.2013.
Stiglitz, J.E./Greenwald, B.C. (2003): Towards a New Paradigm in Monetary Economics, Raffaele Mattioli Lectures, Cambridge: Cambridge University Press.
Stützel, W. (1978): Volkswirtschaftliche Saldenmechanik. Ein Beitrag zur Geldtheorie, 2. Auflage, Tübingen: Mohr Siebeck.
Werner, R. (2014): Can banks individually create money out of nothing? – The theories and the empirical evidence. In: International Review of Financial Analysis 36, S. 1–19.