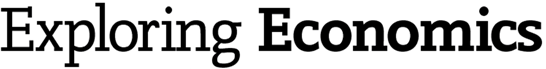Wenn Wirtschaftsweise den Erkenntnisfortschritt bremsen
Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung (FGW), 2016
Wenn Wirtschaftsweise den Erkenntnisfortschritt bremsen
Aus einer Studie zum Meinungsbild im Zeitenwandel unter Deutschlands Ökonomen – und ihren Wortführern in der Öffentlichkeit
Thomas Fricke
Auf einen Blick
- Die systematische Auswertung der großen Umfragen unter Deutschlands Ökonomen seit 2006 zeigt, dass die Basis mittlerweile vielfältiger und offener für Neues ist, als es den Anschein hat.
- Auffällig ist, dass sich dieser vermeintliche Paradigmenwandel in Deutschland nur sehr bedingt in den öffentlichen Debatten zu großen wirtschaftspolitischen Fragen spiegelt, die nach wie vor stark von orthodoxen Vertretern des Fachs geprägt werden.
- Die Erneuerung ökonomischen Denkens stieße sich hierzulande danach sehr stark auch an starren Strukturen und mangelnder Fluktuation in der wirtschaftspolitischen Beratung.
„What is very clearly true, is that German economics is different from economics everywhere else in the world.“
Joseph Stiglitz, August 2016
Ökonomie in Deutschland: Alles anders?
Spätestens seit der großen Finanzkrise haben Deutschlands Ökonomen ihr Image weg: die Zunft gilt als orthodox und einseitig. Ob in Sachen Krisenpolitik der Notenbanken – oder wenn es darum geht, die Wirtschaft anzukurbeln. Ob bei Nobelpreisträgern wie Stiglitz und selbst konservativeren Vertretern im Ausland - oder im Inland, wo nur noch ein Drittel der Menschen den Ökonomen vertraut und Studenten mehr Pluralität in Forschung und Lehre fordern.
Sind deutsche Wirtschaftswissenschaftler tatsächlich per se so dogmatisch festgelegt? Trotz Finanzkrise? Immerhin räumten in der großen Ökonomen-Umfrage 2015 gut 45 Prozent der hiesigen Fachvertreter selbstkritisch ein, dass ihre Zunft in einer Legitimationskrise stecke. Und yx Prozent stimmten zu, dass die Finanzkrise dem Scheitern von „Marktfundamentalismus“ gleichkommt. Das passt nicht recht zur kategorischen Aussage, dass die Ökonomie in Deutschland so grundlegend anders ist. Der Befund könnte ja auch von Stiglitz stammen.
Etwas anderes lässt die systematische Auswertung der großen Umfragen vermuten, die in drei Wellen seit 2006 unter deutschen Ökonomen geführt wurde . Danach gibt es auch in der hiesigen Zunft seit der Finanzkrise Bewegung und eine Tendenz, allzu orthodox-angebotsorientierte Lehren abzulegen. Woran es mangelt, ist eher die Übertragung: der vermeintliche Paradigmenwandel spiegelt sich bisher kaum in den öffentlichen Debatten, die nach wie vor stark von orthodoxen Wortführern geprägt werden, ob aus dem Sachverständigenrat (SVR) oder führenden Forschungsinstituten.
Neue ökonomische Vielfalt an der Basis
Wie sehr sich das Meinungsbild (auch) in der deutschen Ökonomie bereits wandelt, lässt sich im Vergleich der Umfrage 2015 mit der Befragung 2006 kurz vor Ausbruch der Finanzkrise erahnen. Über drei Jahrzehnte waren Ökonomie und Wirtschaftspolitik bis in die 2000er-Jahre - weltweit - von Modellen der Monetaristen und Angebotstheoretiker geprägt, wonach im Kern der Staat fast immer schlechter abschneidet als die heilenden Kräfte des Marktes. Entsprechend waren 2006 nur noch 12 Prozent der deutschen Wirtschaftswissenschaftler der Ansicht, dass die „Finanzpolitik ein effektives Instrument sein (kann), den Konjunkturzyklus zu stabilisieren.“ Im „Hamburger Appell“ erklärten damals mehr als 240 Wirtschaftsprofessoren, dass sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage „einer nachhaltigen Steuerung weitestgehend entzieht“.
Dieses Paradigma scheint durch die Finanzkrise stark angeschlagen – auch in Deutschland. In der ersten Umfrage nach dem Schock stuften 2010 unvermittelt 65,8 Prozent der Befragten den Lieblingsgegner der Angebotslehre John Maynard Keynes (wieder) als „sehr wichtig für die heutige Volkswirtschaftslehre“ ein; 2006 fanden das lediglich 50,5 Prozent. Bis 2015 verdreifachte sich der Anteil derer, die Konjunkturpolitik als potenziell effektives Instrument einstufen auf 36 Prozent. Und: nur noch 8,4 statt 28,8 Prozent (2006) befanden, dass Finanzpolitik unnütz ist, die Konjunktur zu beeinflussen und Zyklen zu glätten.
Auf eine Abkehr vom orthodox-marktwirtschaftlichen Glauben lassen auch die stark gewachsenen Zweifel an der Effizienz von (Finanz-)Märkten schließen. Mehr als zwei Drittel stimmten 2015 „stark“ oder „etwas“ zu, dass ökonomische Modelle in den Jahren vor der Krise „zu stark auf der Annahme rationalen Verhaltens“ (der Menschen) aufgebaut waren. Geschwunden scheint auch das Vertrauen in die Effizienz der Devisenmärkte. Noch 2006 hatten 61 Prozent „im Großen und Ganzen“ oder „mit Einschränkung“ zugestimmt, dass „flexible Wechselkurse zu einer optimalen Allokation von Ressourcen führen“. In der Umfrage 2015 sahen das nur noch 39 Prozent so.

Abbildung 1: Finanzpolitik kann ein effektives Instrument sein, den Konjunktur zyklus zu stabilisieren. Stimmen Sie zu? Antworten in %
Quelle: Ökonomen-Umfragen 2006-2010 sowie Schneider 1981
Gesamtzahl der Antworten: 2015: 903; 2010: 949; 2006: 527
Immerhin gut 40 Prozent stimmen seit 2010 auch dem Befund „stark zu“, wonach „die Finanzkrise gezeigt hat, dass Spekulation destabilisierend statt stabilisierend wirken kann“. Nach monetaristischer Lehre sollte Spekulation ja stets stabilisierend wirken. Das sehen 2015 nur noch knapp 17 Prozent so.
Rund 45 Prozent meinen da, dass die Finanzkrise „in erster Linie das Versagen von (Finanz-)Märkten“ spiegelt – ein ziemlich tief reichender Befund für eine Zunft, die über drei Jahrzehnte vom Glauben an Markteffizienz geprägt war. Und politisch relevant: 42 Prozent der deutschen Wirtschaftswissenschaftler befanden 2015, dass die Empfehlung einer Kapitaldeckung der Rente – über vermeintlich effiziente Finanzmärkte - „nach den Erfahrungen der Finanzkrise“ zu relativieren sei.
Hinter alledem stecken mehr als nur Zweifel im Detail. Immerhin jeder Vierte findet die Kritik von Studierenden an mangelnder Pluralität in der Wirtschaftswissenschaft völlig berechtigt, noch einmal 32,2 Prozent grundsätzlich richtig, nur übertrieben. Macht zusammen fast 60 Prozent, die offen für eine relativ grundsätzliche Kritik sind. Immerhin jeder dritte Fachvertreter stimmte nach Ausbruch der Finanzkrise „stark“ zu, dass Ökonomen „zu stark auf formalisierte Modelle“ setzten. Dass Ökonomen „wieder stärker“ auf Geschichtsforschung zurückgreifen sollten, befürworteten 2015 gut 32 Prozent; weitere 43 Prozent stimmten dem „etwas zu“.
All das mag noch kein Beleg sein, dass die Ökonomie auf dem Weg zu so viel Pluralität ist, wie es sich Kritiker wünschen – oder dafür, dass bereits ein neues Paradigma naht. Genauso wenig passen die Ergebnisse aber zum Befund einer Wissenschaft, die in Orthodoxie erstarrt ist.
Woher kommt dann das Image, dass die Ökonomie in Deutschland so grundsätzlich „anders“ ist (Stiglitz)? Paradox?
Wir sammeln Artikel, Videos und Lernmaterialien und machen sie öffentlich zugänglich. Dafür sind wir auf Unterstützung angewiesen.
Bremsende Wortführer
Die Auflösung könnte darin liegen, dass sich in den Jahren seit Ausbruch der Finanzkrise eine Lücke aufgetan hat zwischen dem, was über die Wortführer der Zunft als „die“ Meinung der deutschen Ökonomen wahrgenommen wird – und dem, was eine zunehmend offene Basis in den Umfragen zum Ausdruck bringt. Um dies zu prüfen, haben wir die Ergebnisse der Umfragen mit den Positionen verglichen, die führende Institutionen der wirtschaftspolitischen Beratung zu aktuellen Streitthemen vertreten haben: etwa zu Euro-Rettungspolitik, deutschen Exportüberschüssen und Mindestlohn. Als Referenz wurden dabei vor allem die Gutachten des Sachverständigenrats (SVR) herangezogen - insbesondere das von 2014 mit dem Titel „Mehr Vertrauen in Marktprozesse“ .
1) Die Euro-Rettungspolitik der Notenbank
Der Sachverständigenrat zeigt wenig Gefallen daran, dass EZB-Chef Mario Draghi zur Rettung des Euro auch einen massiven Aufkauf von Staatsanleihen avisiert. Dadurch würden Fehlanreize gesetzt, der Druck zu Strukturreformen genommen sowie die Abhängigkeit von Staaten und Banken verstärkt. Der Rat enthält sich zwar ausdrücklich einer Antwort auf die (juristische) Frage, ob die EZB damit ihr Mandat überschreitet – führt dann allerdings eine Reihe ökonomischer Argumente an, die auf ein (unerlaubtes) Verwischen der Trennlinie zwischen Geld- und Finanzpolitik hindeuteten . Noch klarer gegen die EZB positioniert sich in dieser Zeit Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn.

Abbildung 2: Eine Notenbank sollte in Krisensituationen die Funktion eines Lenders of Last Resort einnehmen und zur Beruhigung der Finanzmärkte auch den Kauf von Staatsanleihen als Instrument nutzen. Angaben in %
Quelle: Ökonomen-Umfragen 2015
Gesamtzahl der Antworten: 875
In auffälligem Kontrast dazu stehen die Ergebnisse der Umfrage 2015. Darin stimmte bereits gut jeder fünfte deutsche Ökonom uneingeschränkt zu, dass „eine Notenbank in Krisensituationen die Funktion eines Lenders of Last Resort einnehmen“ und „zur Beruhigung der Finanzmärkte auch den Kauf von Staatsanleihen als Instrument nutzen“ sollte. Nur gut jeder Vierte lehnte solche Eingriffe ab. Nur 36,2 Prozent teilten die Kritik, dass die EZB ihr Mandat überschritten habe und nicht hätte intervenieren dürfen. Ein weiteres gutes Drittel zweifelte zwar, dass die EZB innerhalb ihres Auftrags blieb – beurteilte die Intervention aber dennoch als richtig. Und: fast jeder fünfte Experte fand, dass die Währungshüter ihren Auftrag sogar erfüllt haben. Heißt: Nur jeder Dritte verteidigte die klarer ablehnende Haltung.
2) Der deutsche Exportüberschuss
Der Sachverständigenrat zeigt wenig Verständnis für die internationale Kritik an hohen Überschüssen in der deutschen Leistungsbilanz. Es gebe „keinen Grund zu Aktionismus“. In ihrem Gutachten 2014 bestreitet die Mehrheit der Professoren die Diagnose der EU-Kommission, wonach die Ursache überhaupt in einer zu schwachen Inlandsnachfrage liege.
Die Kritik findet an der hiesigen Ökonomen-Basis deutlich mehr Zuspruch. Schon 2010 fand jeder Dritte, dass es „wünschenswert“ wäre, „wenn Deutschland sehr hohe Leistungsbilanzüberschüsse (...) künftig vermeidet“. Immerhin fast die Hälfte befanden 2015, dass es hier Korrekturbedarf gebe – und Deutschland den Anteil der Binnenwirtschaft am Wirtschaftswachstum zumindest graduell erhöhen sollte. Nur ein Fünftel sah gar keinen Korrekturbedarf. Dass der Überschuss das Risiko künftiger (Finanz-)Turbulenzen birgt, sagten dagegen zwei von drei Befragten.
3) Die Einführung des Mindestlohns
Der Sachverständigenrat hat rasch klar gemacht, wie wenig er davon hält, 2015 einen Mindestlohn einzuführen. Solch eine Untergrenze drohe Arbeitsplätze zu kosten. Nach Angebotslehre muss der Lohn frei durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Wo der Mindestlohn nun beschlossen sei, sollte er überprüft und korrigiert werden, mahnt der SVR im Herbst 2014.

Abbildung 1: Wie beurteilen Sie den in Deutschland gerade eingeführten Mindestlohn (2015)? Antworten in %
Quelle: Ökonomen-Umfrage 2015
Gesamtzahl der Antworten: 970
Die Skepsis findet sich nur sehr bedingt unter den Ökonomen insgesamt wieder. So urteilten 2015 immerhin 31,6 Prozent, dass sie den Mindestlohn „alles in allem für nötig und sinnvoll“ halten. Für weitere 25,7 Prozent ist die Untergrenze ebenfalls sinnvoll, nur sei sie mit 8 Euro 50 zu hoch angesetzt. Nimmt man beide zusammen, haben in Deutschland immerhin fast 60 Prozent der Ökonom_innen kein grundsätzliches Problem mit einem Mindestlohn. Die Grundsatzkritik, die Sachverständige und Institutsvertreter_innen äußern, ist in der Minderheit. Nur gut jeder Dritte im Land ist unter allen Umständen dagegen.
Verkrustete Wirtschaftsberatung?
Der Vergleich hat es in sich: in keiner der Streitfragen vertrat der Sachverständigenrat in den jüngsten Jahren offenbar noch Positionen, die von einer klaren Mehrheit der Ökonomen im Land ebenso beurteilt werden. Ähnliches gilt etwa für den Streit um die Ungleichheit von Einkommen oder die Energiewende. Deutlich mehr als die Hälfte stützt sowohl grundsätzlich die EZB in ihrer Euro-Rettungspolitik, als auch die Kritik an deutschen Exportüberschüssen und die Einführung des Mindestlohns – anders als die Mehrheit der Sachverständigen. Und dabei geht es nicht um Petitessen, sondern um wirtschaftspolitisch hoch relevante Fragen, die seit der Finanzkrise akut wurden.
Als das Bundesverfassungsgericht urteilen sollte, ob die EZB ihr Mandat überschritten hat, luden die Richter im Sommer 2013 fünf Wirtschaftsprofessoren ein, die qua Amt als führende Experten gelten: davon sprachen sich vier mehr oder weniger offen gegen den EZB-Kurs aus und nur einer dafür – obwohl, wie die Umfrageauswertungen 2015 gezeigt haben, die meisten deutschen Ökonom_innen zu diesem Zeitpunkt die EZB-Position unterstützten. Sprich: Da hat sich das höchste deutsche Gericht mehrheitlich von Leuten beraten lassen, die de facto eine Minderheitenposition vertraten. Heikel.
Nun sind Mehrheitsverhältnisse in der Wissenschaft natürlich kein Beleg für Richtigkeit. Zumindest sollte es aber einen erhöhten Erklärungsdruck schaffen, wenn diejenigen, die qua Auftrag eine hervorgehobene Rolle in der wirtschaftspolitischen Beratung spielen, in existenziell wichtigen Fragen de facto nur (noch) eine Minderheitenposition vertreten – anders als das bis zur Finanzkrise in vielem sicher noch der Fall war. Zumal in Zeiten, in denen das Vertrauen in die Zunft schwindet.
Eine Erklärung für das Auseinanderdriften zwischen Wortführern und Basis könnte immerhin darin liegen, dass es tatsächlich einen erhöhten Bedarf an neuen Antworten gibt – der an der Basis auch schon zu einer Art Aufbruch geführt hat, wie er in anderen Ländern zu beobachten ist. Nur dass dies in Deutschland nur sehr bedingt Ausdruck findet in den öffentlichen Debatten, in denen nach wie vor Institutionen und Vertreter des Fachs dominieren, die das Denken in den vergangenen Jahrzehnten des angebotsorientierten Paradigmas geprägt haben – ob im Sachverständigenrat, den Instituten oder der Bundesbank. Was wiederum erklären würde, warum trotz zunehmender Offenheit und Vielfalt der Eindruck im In- und Ausland fortbesteht, die deutsche Ökonomie sei anders als alle anderen auf der Welt.
Dann liegt das tiefere Problem weniger im Mangel an Erneuerungsbereitschaft, sondern eher in der stark institutionalisierten wirtschaftspolitischen Beratung in Deutschland – in einem Mangel an Wettbewerb sowie personeller und inhaltlicher Flexibilität. Dann könnte es sinnvoll sein, etwa darüber nachzudenken, wie Wissenschaftler in Beratungspositionen und wieder zurück an die Universitäten wechseln können, wie das weit einfacher in den USA möglich ist. Oder wie zu verhindern ist, dass einzelne Ökonomen eine über so lange Zeit so einsam dominierende Rolle spielen – ob der Langzeit-Ifo-Chef Hans-Werner Sinn oder der Chef des Sachverständigenrats, der gleichzeitig seit vielen Jahren eines der großen Forschungsinstitute leitet. Dann könnte es auch sinnvoll sein, viel stärker alternative Institutionen der Beratung zu fördern, die offener für Erneuerung sind. Um zu verhindern, dass sich Berater mehr als Besitzstandswahrer alter Glaubenssätze verstehen – und weniger als Wissenschaftler mit Praxisbezug, die nach Erkenntnis streben.
Über den Autor: Thomas Fricke – Wirtschaftspublizist und Kolumnist sowie Leiter des Internetportals WirtschaftsWunder. Mitarbeiter am Thünen-Institut in Bollewick und Berlin.
[1] Entropie ist ein Maß für unumkehrbare thermodynamische Prozesse. Alle physikalischen Prozesse zerstreuen Energie (Dissipation), daher steigt in geschlossenen Systemen die Entropie notwendig an, bis alle Energie gleich verteilt, alle verfügbare Energie in nicht verfügbare umgewandelt ist und keine makroskopischen Prozesse mehr möglich sind. Daher sind sich erhaltende (sich reproduzierende) physikalische Systeme (wie das Erdsystem, alle Ökosysteme, alle biologischen Populationen und Organismen und auch alle menschliche Produktions- und Konsumtionsweisen) nur als energetisch offene Systeme möglich, die permanent verfügbare Energie aus der Umgebung aufnehmen (z.B. Sonnenenergie oder in Kohle, Erdöl, Erdgas u.ä. chemisch gespeicherte Sonnenenergie) und die gleiche Energiemenge als nicht verfügbare (zerstreute) Energie, d.h. als Wärmestrahlung, an die Umgebung abgeben. Dies nennt man Entropieexport. Vgl.: Rifkin, Jeremy; Georgescu-Roegen, Nicholas (1982): Entropie: ein neues Weltbild. Hamburg: Hoffmann und Campe.
[2] Diamond, Jared M. (2010): Kollaps: Warum Gesellschaften überleben oder untergehen, 4. Aufl., Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag.
[3] Huber, Joseph (1999): Industrielle Ökologie. Konsistenz, Effizienz und Suffizienz in zyklusanalytischer Betrachtung, VDW-Jahrestagung, Berlin, 28.-29.Oktober 1999, in: Simonis, U. E./Kreibig, R. (2000): Global Change, Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag.