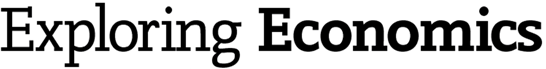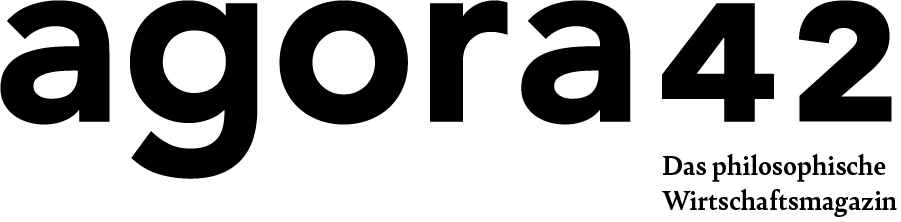Frank Fehlberg
Netzwerk Plurale Ökonomik
Die Volkswirtschaftslehre begnügt sich damit, eine Lehre der Mechanik des aktuellen Wirtschaftssystems zu sein, eine Art Kapitalistik. Es war fahrlässig, bei dieser geschichts- und zukunftslosen Wirtschaftswissenschaft stehenzubleiben. Eine Reise in die Vergangenheit der Disziplin zeigt, dass eine bessere Ökonomik denkbar ist.


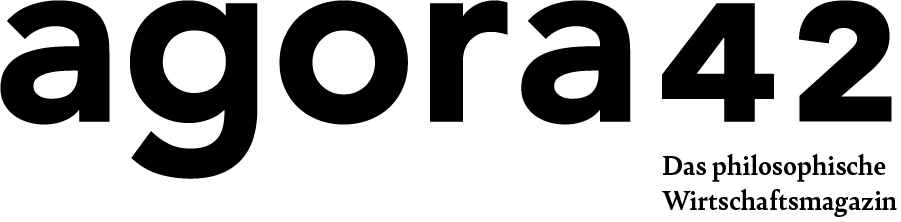
Dieser Artikel wurde auf Agora42 erstveröffentlicht.
In der Kolumne Jenseits von Angebot und Nachfrage nehmen Autor*innen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik die fachlichen Scheuklappen der Lehrbuchökonomie ab und werfen einen pluralökonomischen Blick auf gesellschaftspolitische Fragestellungen.
Agora42 Debattenreihe Spenden
Wenn man die Juristin Katharina Pistor und den Ökonomen Thomas Piketty – zwei Stars des aktuellen Kapitalismus-Diskurses – in ein akademisches Fach einordnen müsste, es wäre wohl die Sozialökonomik. „Sozialökonomik?!“, fragen Sie sich vielleicht. Deren Charakteristik zeigt sich in Pikettys Kapital des 21. Jahrhunderts deutlich an der Verknüpfung von Theorie und Geschichte. Mit Kapital und Ideologie legte er eine Globalgeschichte gesellschaftlicher Ungleichheit vor – eine so ambitionierte Verbindung von Modellökonomik, Statistik und Sozialgeschichte war in der Standardökonomik lange Zeit undenkbar.
Katharina Pistor machte jüngst dort juristisch weiter, wo Ökonom*innen aufgrund ihrer verkürzten Ausbildung meist aufhören (müssen): Kapital sei „kein Gegenstand, sondern eine Qualität“ und der rechtliche Code des Kapitals folge nicht den „Regeln des Wettbewerbs“, sondern vielmehr „der Logik von Macht und Privileg“. Das Kapital zeichne also vor allem eine ethisch-soziale und keine nur sachlich-ökonomische Logik aus. Dieses Urteil aus der Rechtswissenschaft hat neben den Begriffskonstruktionen der VWL allemal seine Berechtigung und erinnert zusammen mit Pikettys Untersuchungen lebhaft an die Anfänge der Sozialökonomik im 19. Jahrhundert. Offenbar brechen sich deren Ausgangspunkte und Grundideen wieder Bahn. Es lohnt sich also, diesem Wissenschaftskonzept nachzuspüren.
Was verbindet Pistor und Piketty mit Max Weber?
Forscht man nach der Sozialökonomik, stößt man unweigerlich auf Max Weber (1864-1920). Der gelernte Jurist, später auch Ökonom und Soziologe, gilt als einer der einflussreichsten Gesellschaftsforscher des 20. Jahrhunderts. Seine Denkwelten reichten von der historischen Bedeutung der protestantischen Ethik für unsere Art des Wirtschaftens bis zur Begründung der Musiksoziologie. Weber bezeichnete die VWL einmal als „Wissenschaft vom Menschen“, die „vor allem nach der Qualität der Menschen fragt, welche durch jene ökonomischen und sozialen Daseinsbedingungen herangezüchtet werden“. Die Ökonomik unserer Zeit hat von derart anthropologischen Weitungen ihres Faches lange Abstand genommen.
Die VWL ist heute keine komplexe Wissenschaft von der Vergesellschaftung der Menschen. Sie ist zur Wissenschaft von den rationalen Abläufen vorgefundener Rechts- und Wirtschaftsformen erstarrt. Zu eigen ist ihr die schlechte Angewohnheit, das historische Sein dieser Formen seit der Französischen Revolution von 1789 zum universellen Sollen zu deklarieren, also bedingte menschliche und gesellschaftliche Zustände als unbedingte und naturgegebene Notwendigkeiten zu begreifen. Webers Fragestellungen nach der „inneren Umbildung“ und „den Zukunftschancen des Kapitalismus“ – welche er in seiner Lehrbuchreihe Grundriss der Sozialökonomik (1914-1930) verhandelte – klingen deshalb für viele „moderne Ökonom*innen“ naiv oder gefährlich. Für andere dagegen, wie Pistor und Piketty, werden sie mit jeder weiteren globalen Krise einfach nur dringlicher.
Tatsächlich wagte Weber, wenn auch bürgerlich-zurückhaltender als Karl Marx (1818-1883), mulmige Prophetien, was die Entwicklungsaussichten des kapitalistischen Wirtschaftens anging. Der „Kosmos der modernen Wirtschaftsordnung, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren werden, mit überwältigendem Zwange bestimmt“, werde herrschen, „bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist“, schrieb Weber 1905.
Sozialökonomik – die andere Wirtschaftswissenschaft
Zu Webers Zeiten galt die Sozialökonomik als interdisziplinäre Angelegenheit zwischen Geschichtsschreibung, Rechts- und Staatswissenschaft sowie der vergleichsweise jungen Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaft. Die wesentlichen Anstöße hatten die europäischen Entwicklungen nach 1789 geliefert, welche die Verschränkung rechtlicher, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Umwälzungen in periodischen Krisenkonjunkturen und antifeudalen Revolutionen offenlegten. Auf solche Dynamiken richtete sich dementsprechend das Erkenntnisinteresse der Sozialökonomik.
Mit dieser Ausrichtung versuchte die Sozialökonomik nichts Geringeres, als das Beste aus der Historischen Schule der Nationalökonomie und der Klassischen Nationalökonomie miteinander zu verbinden. Erstere konzentrierte sich auf die Beschreibung historisch einmaliger Wirtschaftszustände, weshalb ihr Theorielosigkeit und Prognoseunfähigkeit vorgeworfen wurden. Klassik und Postklassik versuchten hingegen, das theoretische System einer Universalwirtschaftslehre aufzubauen, was bald in einem so wirklichkeitsfremden wie dogmatischen Formalismus endete.
Der erste, der eine Synthese dieser beiden großen ökonomischen Disziplinmodelle versuchte, war Karl Rodbertus (1805-1875). Der Jurist und Landwirt erhob 1852 die Gesellschaftswirtschaft zum Gegenstand der Ökonomik, ausdrücklich nicht die Volkswirtschaft und auch nicht die Nationalökonomie. Sein Kollege im Geiste, der Staatswissenschaftler und Soziologe Albert Schäffle (1831-1903), tat es ihm gleich. Er schrieb 1867 eine Einführung in das Gesellschaftliche System der Wirtschaft. Beide postulierten lange vor Max Weber, dass die Wirtschaftswissenschaft eine Mensch- und Menschheitswissenschaft sei.
1842 hatte Rodbertus – ganz nah an der heutigen Position Katharina Pistors – das Kapital nicht nur als vermeintlich wertfreies Produktionsmittel in der Hand der Einzelnen, sondern zugleich als historisch-rechtliches und damit veränderbares soziales Verhältnis definiert. Die Ökonomik seit Adam Smith (1723-1790), so Rodbertus, habe zu einseitig so „getan, als ob die Gesellschaft nur eine Summe verschiedener wirtschaftlicher Einer, ein mathematisches und kein moralisches, denn das heißt soziales Ganze wäre“ und als sei die Wirtschaft „nur ein Aggregat individueller Wirtschaften und keine organische Gesamtwirtschaft“. Schäffle forderte 1861 eine „ethisch-anthropologische“ Disziplin und stellte den klassischen Ausgangspunkt von quasi-physikalischen Produktionsfaktoren wie Kapital und Arbeit in Frage. Für ihn war Wirtschaft „Kulturtätigkeit“, kein „Naturprozess“: „der reale, kulturhistorische Mensch [ist] der treibende Mittelpunkt, der Faktor im eigentlichen Sinne des Wortes“.
Streit belebt das Geschäft: Über Ethik und Methoden
Im Methodenstreit der Nationalökonomie ab etwa 1880 wurde die Frage von geschichtlicher oder theoretischer Erkenntnis zum Auslöser harter wissenschaftspolitischer Auseinandersetzungen. Große Prominenz erlangte das Duell des Underdogs und „Theoretikers“ Carl Menger (1840-1921) mit dem „Historiker“ und Starökonomen Gustav Schmoller (1838-1917). Letzterer verteidigte die „historische Methode“ gegen die Versuche Mengers, theoretische Geschlossenheit und methodologischen Individualismus voranzubringen. Menger attestierte der Historischen Schule eine ausufernde „Vielseitigkeit“, was Schmoller unter Verweis auf die komplexe Realität als außerordentliches Lob erachtete.
Der Streit führte vor Augen: Die Zeit der Sozialökonomik als integrativer Einzelwissenschaft war gekommen. So unterschiedliche Ökonomen wie der Berliner Altmeister der Staatswissenschaften Adolph Wagner (1835-1917) oder der „deutsche Klassiker“ Heinrich Dietzel (1857-1935) machten sich im Gefolge von Rodbertus und Schäffle in den 1890er-Jahren an den Entwurf einer Theoretischen Sozialökonomik. Auch aus diesen ersten Versuchen, Geschichte und Theorie als verbundene Erkenntniswege für die Ökonomik zu erschließen, gingen schließlich Max Webers Bemühungen um die Weiterentwicklung der Sozialwissenschaften hervor.
Im Werturteilsstreit, der sich nahtlos an den Methodenstreit anschloss, stellte Weber zudem die ethischen Grundlagen der Ökonomik zur Debatte. Sein Hauptziel war es, die damalige institutionelle Dominanz der Historischen Schule sowie ihre wissenschaftlich maskierten „Kulturwerte“ und politökonomischen „Professoren-Prophetien“ infrage zu stellen. Generell aber wandte er sich gegen die „Naivität […], für die praktische Sozialwissenschaft vor allem ‚ein Prinzip‘ aufzustellen und wissenschaftlich als gültig zu erhärten, aus welchem alsdann die Normen für die Lösung der praktischen Einzelprobleme eindeutig deduzierbar seien.“ Gegen die Verengung auf die eine Methode brachte Weber unter anderem den wissenschaftsphilosophischen Neukantianismus [1] in Anschlag. Dieser sprach sich für einen erkenntnistheoretischen Pluralismus zur Erfassung der Wirklichkeit aus. Im Vordergrund sollte die Problemorientierung und nicht die Objektfixierung als Zweckbestimmung einer Wissenschaft stehen.
Zwischen Wirklichkeit und Exaktheit: Sozialökonomik heute
Nach Webers Tod 1920 und in den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg war die VWL intensiver denn je als wirtschaftspolitische Wissenschaft gefragt. Aber nicht die sozialökonomische Synthese von Theorie und Geschichte setzte sich wissenschaftstheoretisch in der Fachstruktur durch. Stattdessen dominieren bis heute postklassische Wirtschaftstheorien das Fach, die sich sowohl als exakte als auch praktische Lehren verstehen. Sozialökonomisch geprägte Konzepte wie die Theorie der Wirtschaftsstile bzw. Wirtschaftssysteme aus den 1920er-Jahren oder der Entwurf der Sozialen Marktwirtschaft aus den 1930er und 1940er-Jahren sind heute als Phänomene einer disziplinären Möglichkeits- und Erwägungskultur längst vergessen oder inhaltsleer geworden.
Hoffnung machen nicht nur implizite Fortsetzungen der sozialökonomischen Tradition wie durch Katharina Pistor und Thomas Piketty. Einige der heutigen Sozial- oder Sozioökonomie genannten Ansätze folgen dem Programm der Socio-Economics des Kommunitaristen Amitai Etzioni, welches der älteren Sozialökonomik noch ähnlicher sieht. Andere haben eine „Sozialwissenschaft der Wirtschaft“ im Sinn, wie Reinhold Hedtke von der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (GSÖBW). Die Wiener Soziologin und Wissenschaftshistorikerin Gertraude Mikl-Horke, die beste Kennerin der sozialökonomischen Wissenschaftsidee, fasst die Gemeinsamkeit traditioneller und aktueller Bemühungen um disziplinäre Selbstfindung zusammen: „Wie schon Weber aufzeigte, wird die Sozioökonomie nicht durch Objektbereiche, sondern durch die Problemstellung bestimmt.“
Besteht die Chance, dass nach den methodologischen Alleinherrschaften der Geschichte im 19. und der Theorie im 20. Jahrhundert endlich doch eine menschengerechte Wirtschaftswissenschaft die Weltbühne betritt? Oder bleibt die VWL eine bloße Wirtschaftstheorie des bestehenden Verfügungsregimes über Mensch und Natur? Optimismus und Pessimismus hin oder her – wir sind es uns und mittlerweile auch dem Planeten schuldig, neue Zukünfte zu denken!

Frank Fehlberg ist promovierter Historiker und Ökonom. Im Umfeld des Netzwerks Plurale Ökonomik e.V. ist er u.a. für die Online-Lernplattform Exploring Economics tätig. Außerdem engagiert er sich bei den Economists for Future, die für wissenschaftlichen Pluralismus und eine sozial-ökologische Transformation eintreten. Als Mitglied der Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft setzt er sich für die Etablierung einer Forschung und Lehre ein, die das historische Zusammendenken von Sozial- und Wirtschaftswissenschaften mit den Problemstellungen von Gegenwart und Zukunft verbindet.
Vom Autor empfohlen:
| SACH-FACHBUCH |
|
ROMAN |
|
FILM |
|
Gertraude Mikl-Horke: Traditionen, Problemstellungen und Konstitutionsprobleme der Sozioökonomie, in: Reinhold Hedtke (Hg.): Was ist und wozu Sozioökonomie? (Springer VS, 2015, S. 95ff)
Christian Fridrich, Reinhold Hedtke & Georg Tafner (Hg.): Historizität und Sozialität in der sozioökonomischen Bildung, (Springer VS, 2019)
|
|
Max Frisch:
Homo faber. Ein Bericht (Zuerst 1957)
|
|
Koyaanisqatsi von Godfrey Reggio (1982)
Lucy von Luc Besson (2014)
|
[1] Der Neukantianismus bezeichnet eine philosophische Strömung zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert. Ihr Ziel war es – in Anlehnung an Immanuel Kant –, eine dritte Position zwischen den Denkschulen des (romantischen) Historismus und des (materialistischen) Naturalismus zu begründen. Bereits für Kant war Erkenntnis nicht ohne den Rückgriff auf Erfahrung und Verstand möglich: „Alle Kultur der Erkenntnisvermögen teilt sich in zwei Zweige auf: Geschichte und Philosophie.“ Der sogenannten Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus um Wilhelm Windelband (1848-1915) und Heinrich Rickert (1863-1936) gelang die Formulierung einer Erkenntnistheorie, die zugleich die Unterschiedlichkeit wie die Berechtigung mehrerer Erkenntniswege zur Erfassung der Wirklichkeit vertrat.
This material has been suggested and edited by: