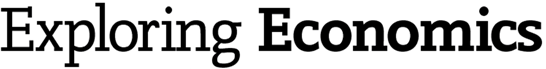Neues Geld – Wie wir Geldpolitik neu denken können
Netzwerk Plurale Ökonomik, 2023


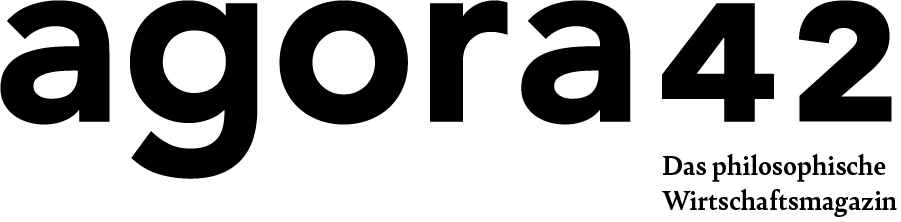
Dieser Artikel wurde auf Agora42 erstveröffentlicht.
In der Kolumne Jenseits von Angebot und Nachfrage nehmen Autor*innen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik die fachlichen Scheuklappen der Lehrbuchökonomie ab und werfen einen pluralökonomischen Blick auf gesellschaftspolitische Fragestellungen.
Wenn wir Gesetze erlassen, wenn wir Verfassungen schreiben, wenn wir staatliche Institutionen konstruieren, dann greifen wir dabei immer auf Ideen und Theorien zurück. Theorien, die die Funktionsweise dieser Gesetze und Institutionen zu erklären versuchen. Wenn sich nun die Landschaft der Ideen und Theorien verändert, erkennen wir manchmal, dass in der Vergangenheit erdachte Gesetze und Organisationen fehlerhaft oder unvollständig sind.
Das passiert gerade mit einer zentralen Institution der Europäischen Union: mit der Europäischen Zentralbank (EZB). Seit Jahren steht sie in der Kritik. Mal, weil die Inflation zu niedrig ist, so wie in den vergangenen zehn Jahren. Mal, weil sie zu hoch ist, so wie heute.
Ich möchte in diesem Text argumentieren, dass die EZB in ihrer aktuellen Konstruktion eine Institution ist, die aus heute überholten Theorien heraus entstanden ist. Hier mag auch der Ursprung der anhaltenden Kritik an der EZB liegen. Die EZB hat das Mandat der Preisstabilität, was bedeutet, sie zielt auf eine niedrige, aber positive Inflation von 2 Prozent ab. Das hauptsächliche Instrument, das wir ihr für die Erfüllung dieses Mandats an die Hand gegeben haben, ist der Leitzins. Dieser stellt sich als überraschend unpraktisch für dieses Ziel heraus, weil er keine spezifischen Sektoren adressieren kann, sondern nur die gesamte Wirtschaft. Gleichzeitig lassen wir als Gesellschaft das Gestaltungspotenzial ungenutzt, das in der Geldschöpfung und Kreditvergabe liegt.
Die EZB ist eine Grobmotorikerin – und wir haben sie dazu gemacht
Zwei Probleme der jüngeren Vergangenheit illustrieren, welchen Schwierigkeiten die EZB in ihrer aktuellen Konstruktion begegnet.
Ein Problem ist die aktuelle Inflation. Es ist gemeinhin anerkannt, dass es sich um eine angebotsgetriebene Inflation handelt. Das heißt: In einigen Sektoren gab es schnelle Preissteigerungen, die sich dann auf andere Sektoren ausgeweitet haben. Zum Beispiel die hohen Energiepreise oder Knappheiten durch unterbrochene Lieferketten.
Die EZB kann Preissteigerungen in einem bestimmten Sektor aber nicht ansteuern. Mit einer Leitzinserhöhung, die Kredite verteuert und damit Investitionen reduziert, trifft sie immer die gesamte Wirtschaft. Sie haut – um es mit den Worten der Denkwerkstatt Dezernat Zukunft zu sagen – wie in Zeitlupe mit einem großen Hammer auf die gesamte Wirtschaft.
Und dabei kommt es eben zu Kollateralschäden. Besonders kapitalintensive Sektoren, wie der Bausektor oder die erneuerbaren Energien, leiden unter den höheren Kreditkosten und brechen zusammen. Wenn man die aktuelle Inflation bekämpfen will, hilft das allerdings kaum. Und wir zahlen dafür einen hohen Preis – den Preis einer erhöhten Arbeitslosigkeit und weniger wirtschaftlicher Aktivität. Denn höhere Kreditkosten und weniger Investitionen bedeuten auch mehr Entlassungen und weniger Einstellungen.
Das zweite Problem trat in den 2010er-Jahren auf, in denen die EZB notorisch unter ihrem Inflationsziel lag. Sie versuchte, durch sehr niedrige Zinsen und den Kauf von Staatsanleihen die Nachfrage zu stärken, die Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation auf diese Weise zu steigern.
Aber auch hier wurde ihr das eher breite Instrument des Leitzinses zum Verhängnis. Das billige Geld wurde zum Großteil nicht für Investitionen in realwirtschaftliche Projekte genutzt. Es floss in Aktien und Immobilien und führte nur in diesen Bereichen zu einer sogenannten Vermögenspreisinflation, von der besonders Aktien- und Immobilienbesitzer*innen profitierten. Wieder konnte die EZB keine spezifischen Sektoren ansteuern. Und wieder führte das zu unerwünschten Verteilungseffekten.
Wir haben der EZB also ein Mandat erteilt: die Preisstabilität. Wir haben ihr aber, um dieses Ziel zu erreichen, den Leitzins als Instrument an die Hand gegeben – und sie so zur Grobmotorikerin gemacht.
Wie kamen wir darauf, dass das eine gute Idee wäre?
Eine Zentralbank, zwei Ideen
Die aktuelle Konstruktion der EZB lässt sich mit zwei theoretischen Ansätzen erklären, die teilweise bis heute eine große Rolle in der ökonomischen Debatte spielen.
Erstens herrscht die Idee vor, dass Inflation immer nur ein makroökonomisches, gesamtwirtschaftliches Problem ist. Monetarist*innen gingen von einer insgesamt zu hohen Geldmenge aus, die zu starken Preisanstiegen führt. Keynesianische Denker*innen machen dagegen eine zu hohe gesamtwirtschaftliche Nachfrage für Inflationen verantwortlich. Doch, während die Theorie der Monetarist*innen heute kaum noch Bedeutung hat, übten sie bei der ursprünglichen Konstruktion der EZB sicherlich großen Einfluss aus.
Beide Theorien haben gemein, dass sie Inflation nur als makroökonomisches Phänomen erklären. Und wenn man meint, dass das Problem ein gesamtwirtschaftliches ist, dann kann man auch mit sehr breiten und nicht sektorenspezifischen Instrumenten reagieren. Oder anders gesagt: Dann hämmert man grobmotorisch auf die ganze Wirtschaft drauf.
Die zweite Theorie, die wir hier betrachten wollen, dreht sich um das Wesen des Geldes. Es gibt diverse Ansichten darüber, was Geld im Kern ausmacht. Eine mögliche Antwort auf diese Fragen gibt die Warentheorie. Sie besagt, dass sich Geld eigentlich nicht von anderen tauschbaren Waren wie Brot, Eiern oder T-Shirts unterscheidet. Geld ist demnach eine besonders einfach tauschbare Ware.
Wenn ich beispielsweise Brot anzubieten habe und Eier kaufen möchte, dann muss ich nicht erst jemanden suchen, der Brot und Eier tauschen will. Ich kann stattdessen mein Brot für Geld an eine Person verkaufen. Und später kann ich bei einer anderen Person mein Geld dann für Eier eintauschen. So macht das Geld das Tauschen einfacher. Es ändert aber nichts daran, welche Güter ich produziere oder konsumiere.
Heißt also: Laut Warentheorie ist es für die Wertschöpfung und die wirtschaftlichen Resultate einigermaßen egal, woher das Geld kommt. Wichtig ist nur die Rolle, die das Geld beim Tausch spielt. Dabei soll sich sein Wert nicht allzu schnell ändern. Und deshalb möchte man die Inflation verhindern.
Die Warentheorie erklärt auch, warum unsere Geldpolitik so ist, wie sie im Moment ist. Denn wir scheren uns derzeit nicht wirklich darum, woher das Geld kommt, das wir tagtäglich nutzen, und wer es schöpft. In der Tat ist der allergrößte Teil der Geldschöpfung in unserem aktuellen System privaten Geschäftsbanken überlassen. Diese schaffen, wenn sie Kredite vergeben, per Knopfdruck Geld. Geld von der Zentralbank benötigen sie nur für den Handel mit anderen Banken, für eine Mindestreserve und für die Ausgabe von Bargeld.
Dadurch hat die EZB einen, wenn auch begrenzten, Einfluss auf die privaten Banken. Die Leitzinsen zu erhöhen, heißt, dass es für Banken teurer wird, sich bei der EZB Geld zu leihen, das sie beispielsweise für Überweisungen an andere Banken brauchen. Und steigt der Leitzins, werden auch Banken ihre Kredite an Privatkund*innen und Unternehmen verteuern.
Über diesen Hebel kann die EZB die Wirtschaft in Maßen dämpfen oder fördern: Sie kann die Geldschöpfung auf sehr hoher Ebene beeinflussen, aber nicht sektorenspezifisch. Sie kann eben nicht bestimmen, dass die Zeit der Niedrigzinsen für die Realwirtschaft genutzt werden soll. Die privaten Geschäftsbanken entscheiden selbst, an welchen Sektor sie ihre Kredite vergeben – das ist der Profitabelste. Dann kann es wie in den vergangenen zehn Jahren zu einer Inflation von Aktien- und Immobilienpreisen kommen, während die Realwirtschaft und die Reallöhne stagnieren.
Inflation und Geldschöpfung: Zwei neue Ideen
Aber wie sehen das eigentlich Wissenschaftler*innen heutzutage? In der Ökonomik hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan, sowohl wenn es um die Rolle des Geldes als auch um die Bekämpfung der Inflation geht. Aus diesen neuen Theorien lassen sich einige kluge Vorschläge ableiten, wie wir unsere Geldpolitik erneuern können.
Zuerst zur Inflation: Isabella Weber, bekannt geworden als „Erfinderin der Gaspreisbremse“, hat zwei lehrreiche Papiere zur aktuellen Inflation geschrieben. Sie wirft den vorhin erklärten makroökonomischen Ansätzen vor, wichtige Elemente der Entstehung von Inflation zu unterschlagen. In der keynesianischen und monetaristischen Erklärung von Inflation kommen nämlich Aspekte wie Marktmacht, Profite und angebotsgetriebene Inflation höchstens als Nebenfiguren vor. Weber sieht in diesen Elementen allerdings die zentralen Ursachen der momentanen Inflation.
Was meint sie damit? Weber erklärt die Inflation mit den gestiegenen Energiepriesen und den unterbrochenen Lieferketten, die Vorprodukte verknappen und damit teuer machen. Beobachten kann man den Preisanstieg zum Beispiel in der Chemie, in der Landwirtschaft und im Energiesektor. Diese Sektoren versorgen andere Bereiche der Wirtschaft, sodass sich die Preiserhöhungen ausbreiteten. Die Unternehmen gaben die höheren Preise zum Schluss an die Kunden weiter.
Vorwerfen kann man das Unternehmen nicht: Sie wollen ihre Profite schützen. Einige Firmen haben ihre Preise aber noch weiter erhöht und damit auch gleich ihre Profite. Hierbei sind zwei Mechanismen wichtig: Wenn sich das Angebot an Vorprodukten verknappt, weil die Lieferketten zusammengebrochen sind, muss ein Unternehmen, das seine Preise erhöht, keine Angst haben, dass ihm der Marktanteil von anderen Unternehmen genommen wird. Denn die anderen Unternehmen haben in diesem Fall, wegen der begrenzten Vorprodukte, keine Möglichkeit ihre Produktion zu erhöhen. Die Kund*innen können die Produkte also nicht einfach von anderen Unternehmen kaufen. Unterm Strich kann ein Unternehmen genauso viel verkaufen wie vorher, aber höhere Preise verlangen.
Der zweite Mechanismus hängt damit zusammen, dass die Probleme mit den hohen Energiepreisen und kollabierten Lieferketten in der Öffentlichkeit sehr präsent waren. Das haben einige Unternehmen gegenüber ihren Kund*innen als Rechtfertigung genutzt, die Preise zu erhöhen. Für dieses Phänomen gibt es sogar einen eigenen Begriff: „Excuseflation“. Heißt also: Solange eine überzeugende Entschuldigung für die Preiserhöhungen vorgebracht wird, hören die Kund*innen nicht auf, bei einem Unternehmen einzukaufen.
Auf diese Prozesse kann dann laut Isabella Weber zwar immer noch ein Konflikt zwischen Arbeitnehmer*innen und Unternehmen folgen. Arbeitnehmer*innen wollen Löhne, die der Inflation angepasst sind. Die Unternehmen wollen hingegen ihre Profite schützen, sodass eine Lohn-Preis-Spirale entstehen kann. Getrieben hat die aktuelle Inflation aber vielmehr eine Preis-Profit-Spirale. Oder wie Weber das nennt: eine „Sellers‘ Inflation“.
Bevor wir uns den politischen Konsequenzen dieser neuen Einsichten zuwenden, nehmen wir uns noch kurz Zeit für eine andere Entwicklung. Diese betrifft das Wesen des Geldes. Der Warentheorie setzen deutsche Forschende wie Aaron Sahr, Carolin Müller, Frido Karth und Joscha Wullweber inzwischen neue Ideen entgegen. Sie betrachten Geld nicht als neutrales Schmiermittel ohne Einfluss auf realwirtschaftliche Resultate. Geld und Geldschöpfung sind ihnen zufolge vielmehr eine Grundbedingung unserer aktuellen Wirtschaftsform. Es wird ja nicht erst produziert und dann fällt das Geld vom Himmel.
Das Gegenteil ist der Fall: Wird eine Ware produziert, nimmt ein Unternehmen dazu in aller Regel zuerst einen Kredit bei der Bank auf, um in Maschinen, Technik oder Personal zu investieren. Der Kredit ist aber nichts anderes als Geld, das von der Geschäftsbank geschöpft wird. Bedeutet: Geldschöpfung ist konstitutiv für Wertschöpfung. Und damit wird auch auf einen Blick klar, dass die Art, wie wir Kredite vergeben beziehungsweise Geld schöpfen, ziemlich reale Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Verteilung von Wohlstand haben kann. Es können ja nur die Aktivitäten in größerem Maßstab durchgeführt werden, für die Kredite bereitgestellt werden. Geld ist, um es mit Aaron Sahr zu sagen, eine „politische Infrastruktur“, die wir verschiedenen Sektoren bereitstellen können. Überlassen wir die Kreditvergabe privaten Banken, dann erhalten eben nur solche Sektoren diese Infrastruktur, die am profitabelsten sind. Für ein gutes Leben brauchen wir aber nicht nur Aktien und Immobilien.
Geld als kritische Infrastruktur
Wenn wir Geld als eine Infrastruktur begreifen, und Geldschöpfung als konstitutiv für die Wertschöpfung, dann muss die Geldschöpfung wieder zum Gegenstand politischer Richtungsentscheidungen werden. Und wenn einzelne Sektoren eine ganze Inflation auslösen können, dann brauchen wir zur Inflationsbekämpfung Instrumente, mit denen wir einzelne Bereiche der Wirtschaft ansteuern können. Neue Ideen fordern neue Institutionen. Wie könnten diese neuen Institutionen und Gesetze aussehen?
Isabella Weber schlägt vor, Reserven und Puffer für die kritischen Sektoren der Volkswirtschaft anzulegen, deren Preise sich auf die restlichen Bereiche ausbreiten können. Außerdem könnten für Situationen wie die aktuellen Lieferkettenprobleme Regeln eingeführt werden, die übermäßige Preiserhöhungen verbieten. So könnte verhindert werden, dass Unternehmen unterbrochene Lieferketten für Profitsteigerungen ausnutzen und so die Inflation antreiben. Langfristig kann der Staat in die kritischen Sektoren und Lieferketten investieren, um künftigen Krisen vorzubeugen. Das alles sind Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung, die sich in zwei Hinsichten vom heutigen Ansatz unterscheiden. Erstens greifen sie gezielter auf bestimmte Sektoren zu. Und zweitens wird der parlamentarischen Politik eine wichtigere Rolle als bisher zugetraut.
Was die Geldschöpfung angeht, müssen wir uns überlegen, ob wir das Geld als kritische Infrastruktur tatsächlich in diesem Maße der Kontrolle privater Akteure überlassen wollen. Eine Alternative wäre es, das Mandat der EZB zu ändern: Sie müsste dann nicht nur auf Preisstabilität achten, sondern dürfte auch bestimmten, als gesellschaftlich besonders wertvoll anerkannten Wirtschaftszweigen bessere Kreditbedingungen ermöglichen. Ein zweiter Vorschlag besteht in einer größeren Rolle für staatliche Entwicklungsbanken: Banken, die auch Kredite und Förderungen vergeben, aber in staatlichem Auftrag. Zuletzt muss mindestens darüber diskutiert werden, ob die Möglichkeiten ausgeweitet werden sollen, mit denen die EZB Staaten und ihre Projekte finanziert.
Wenn wir uns im Denken weiterentwickeln können, dann wohl auch im Handeln. Wir können nur hoffen, dass sich das neue Verständnis von Geld über kurz oder lang auch darin niederschlägt, dass wir in Zukunft besser für Inflationen gewappnet sind, und dass wir das Potenzial des Geldes als politischer Infrastruktur zu nutzen wissen.

Kilian de Ridder hat Wirtschaftswissenschaften und Philosophie in Halle an der Saale studiert. Er ist Teil des Arbeitskreises Kritischer Wirtschaftswissenschaftler*innen in Halle an der Saale und des Netzwerks Plurale Ökonomik. Er engagiert sich außerdem bei Fiscal Future in einer Arbeitsgruppe zur Steuerpolitik. Er interessiert sich für Geld- und Fiskalpolitik, Klimapolitik und ökonomische Ideengeschichte.
Vom Autor empfohlen:
Philippa Sigl-Glöckner: Der Zinshammer – Wie Zentralbanken Inflation bekämpfen (Geldbrief, 28.01.2022)
Sara Schulte und Max Krahé: Bausektor meets Zinshammer (Geldbrief, 09.02.2023)
Fiscal Future: Inflation in der medialen Debatte (fiscalfuture.de/blog, 2023)
Friedo Karth, Carolin Müller & Aaron Sahr: Geldschöpfungspolitik. Missverständnisse und Missverhältnisse monetärer Souveränität in Europa (III) (Soziopolis, 04.02.2020)
Isabella M. Weber, Jesus Lara Jauregui, Lucas Teixeira & Luiza Nassif Pires: Inflation in Times of Overlapping Emergencies: Systemically Significant Prices from an Input-output Perspective (UMass Amherst Economics Department Working Paper Series 340/2022)
Isabella M. Weber & Evan Wasner: Sellers’ Inflation, Profits and Conflict: Why can Large Firms Hike Prices in an Emergency? (UMass Amherst Economics Department Working Paper Series 343/2023)
Joscha Wullweber: Zentralbankkapitalismus (Suhrkamp, 2021)