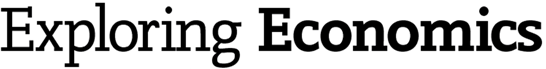Welches Menschenbild für die ökonomische Bildung?
Wirtschaft neu denken: Blinde Flecken in der Lehrbuchökonomie, 2016
Welches Menschenbild für die ökonomische Bildung?
Nicht-egoistisches Verhalten und soziale Vergleiche in der Haushaltstheorie
Quelle: van Treeck, Till, and Janina Urban. Wirtschaft neu denken: Blinde Flecken in der Lehrbuchökonomie. iRights Media, 2016. Das Buch kann hier bestellt werden: http://irights-media.de/publikationen/wirtschaft-neu-denken/.
Ein zentrales Anliegen der meisten Standardlehrbücher besteht darin, den Studierenden ein bestimmtes Menschenbild näherzubringen: Es geht um den berühmt-berüchtigten Homo oeconomicus, der als rationales und eigennütziges Wesen alternative Güter beziehungsweise Handlungen gegeneinander abwägt, um seine tendenziell unendlichen Bedürfnisse mit knappen Mitteln möglichst effizient zu befriedigen. Der Homo oeconomicus findet insbesondere Anwendung im neoklassischen Standardmodell der Haushaltstheorie, das so gut wie alle Studierenden, selbst wenn sie nur eine einzige volkswirtschaftliche Lehrveranstaltung besuchen, in Grundzügen erlernen müssen. Immer häufiger wird auch gefordert, dass Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen verstärkt mit dem ökonomischen Verhaltensmodell und dem daraus abgeleiteten Verständnis von Knappheit vertraut gemacht werden sollten. So lauten die beiden ersten Lernziele des Bildungsplans für das neue Fach Wirtschaft an baden-württembergischen Gymnasien für die Oberstufe: „Die Schülerinnen und Schüler können Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns erkennen; das ökonomische Verhaltensmodell darlegen und die Begriffe Präferenzen und Restriktionen sachgerecht anwenden.“ (Bildungsplan Baden-Württemberg, S. 255)
Im Folgenden wird die Darstellung der mikroökonomischen Haushaltstheorie in den beiden wohl einflussreichsten Ökonomie-Lehrbüchern aller Zeiten – „Grundzüge der Volkswirtschaftslehre“ von N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor und „Volkswirtschaftslehre“ von Paul A. Samuelson und William D. Nordhaus – beschrieben und mit alternativen Modellen menschlichen Verhaltens kontrastiert, wie sie im Lehrbuch „Microeconomics and Behavior“ von Robert H. Frank und Edward Cartwright entwickelt werden, das leider nicht in deutscher Sprache verfügbar ist. Aus meiner Sicht sind die Schwächen des Homo-oeconomicus-Standardmodells, wie es in Mankiw/Taylor, Samuelson/Nordhaus und vielen anderen Lehrbüchern derzeit gelehrt wird, so gravierend, dass auf den Einsatz dieser Lehrbücher im Bereich ökonomischer Verhaltensmodelle verzichtet werden sollte. Zunächst ist Lörwald/Müller (2012, S. 448) zuzustimmen, dass die im Homo-oeconomicus-Standardmodell angelegte Eigennutzmaximierung kein empirisch sinnvolles und normativ akzeptables Bildungsziel darstellt, weil „die für Bildungsprozesse bedeutsame Dimension der (sozialen) Verantwortung unberücksichtigt [bliebe], wenn ausschließlich der größte eigene Vorteil als erstrebenswert gelten würde.“[1] Allerdings lassen Lörwald/Müller ebenso wie Mankiw/Taylor und Samuelson/Nordhaus die Frage unbeantwortet, welche Verhaltensannahme an die Stelle des Egoismus-Axioms treten könnte. Frank/Cartwright zeigen demgegenüber, dass zum einen ohne die Eigennutz-Annahme vom Homo-oeconomicus-Standardmodell wenig übrig bleibt und zum anderen aus evolutorischer Perspektive authentisch nicht-egoistisches Verhalten systematisch mit ökonomischen Vorteilen verbunden sein kann. Eine weitere Schwäche des Homo-oeconomicus-Standardmodells ist, dass es die Abhängigkeit individueller Präferenzen von sozialen Vergleichen ignoriert. Die Berücksichtigung von „positionalen Externalitäten“ in Frank/Cartwright führt auch zu einer differenzierteren Sicht auf Knappheit und Effizienz als in Mankiw/Taylor und Samuelson/Nordhaus.
Die Rationalitätsannahme
Die wichtigste Eigenschaft des Homo oeconomicus ist seine Rationalität. Die ersten drei der „zehn volkswirtschaftlichen Regeln“ von Mankiw/Taylor präzisieren, was in neoklassischen Standardlehrbüchern mit Rationalität gemeint ist. Regel Nummer 1 lautet: „Alle Menschen stehen vor abzuwägenden Alternativen.“ (MT, S. 2) Damit eng verbunden ist Regel Nummer 2: „Die Kosten eines Gutes bestehen in dem, was man dafür aufgibt.“ (MT, S. 4) Die sogenannten Opportunitätskosten eines Gutes beziehungsweise jeder Aktivität bestehen darin, dass die Entscheidung für ein Gut beziehungsweise eine Handlung immer eine Entscheidung gegen andere Güter beziehungsweise Aktivitäten ist, weil ja jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann und jede Minute nur einmal verbracht werden kann. Regel Nummer 3 schließlich postuliert: „Rational entscheidende Menschen denken in Grenzbegriffen.“ (MT, S. 5) Das bedeutet, dass Menschen sich stets fragen, ob eine zusätzliche Einheit eines Gutes beziehungsweise eine weitere Stunde/Minute/Sekunde einer Aktivität noch durch einen hinreichend hohen „Grenznutzen“ im Vergleich zu den hierdurch zusätzlich anfallenden Kosten („Grenzkosten“) gerechtfertigt ist.
Das mikroökonomische Standardmodell der rationalen Konsumentscheidung
Im „mikroökonomischen Standardmodell“ (MT, S. 135 ff.) werden die Studierenden mit der conditio humana in der modernen Konsumgesellschaft bekannt gemacht: „Wenn Sie ein Geschäft betreten, werden Sie mit dem Angebot Tausender Güter konfrontiert. Da Ihre finanziellen Mittel jedoch begrenzt sind, können Sie nicht alles kaufen, was Sie sich wünschen.“ Doch keine Sorge: Es wird angenommen, dass Sie, sofern Sie rational handeln, „unter Berücksichtigung der Preise der verschiedenen Güter ein Bündel erwerben werden, das bei gegebener Mittelausstattung Ihren Bedürfnissen und Wünschen am besten entspricht.“ (MT, S. 135) Mankiw/Taylor treffen dabei die folgenden Annahmen: „Konsumenten (häufig auch als ‚Agenten‘ bezeichnet) sind rational. Es wird lieber mehr als weniger konsumiert. Konsumenten streben nach Nutzenmaximierung. Konsumenten werden von Eigeninteressen gesteuert und berücksichtigen nicht den Nutzen anderer.“ (MT, S. 136)
Eine weitere zentrale und in Mankiw/Taylor und Samuelson/Nordhaus nicht weiter problematisierte Annahme ist, dass die individuellen Präferenzen als exogen gegeben angesehen werden und den nicht weiter hinterfragten Geschmack der Individuen widerspiegeln: „Wertschätzung ist ein individueller Begriff: Was für das eine Individuum einen Wert darstellt, muss für das andere noch lange kein Wert sein.“ (MT, S. 136)
Auf diesen oder sehr ähnlichen Annahmen fußt die allen Studierenden der Volkswirtschaftslehre (VWL) bekannte grafische Darstellung des mikroökonomischen Standardmodells im zweidimensionalen Güterraum (Abb. 1a):
Die Budgetgerade ergibt sich aus dem Einkommen des Individuums und aus den Preisen der betrachteten Güter. Die Indifferenzkurven ergeben sich aus den individuellen Präferenzen und bilden mögliche Kombinationen von Gütern ab, die dem/r Konsumenten/in denselben Nutzen verschaffen. Die Indifferenzkurven verlaufen konvex mit negativer Steigung: „Wenn sich die Menge des einen Gutes verringert, muss sich […] die Menge des anderen Gutes vergrößern, um den Konsumenten gleichermaßen zufriedenzustellen“, wobei „die Menschen […] nur in geringem Maße gewillt sind, von demjenigen Gut, von dem sie sowieso schon wenig haben, etwas herzugeben“ (MT, S. 147–148). Außerdem sind die Bedürfnisse der Konsument_innen nicht gesättigt: Eine höhere Indifferenzkurve würde mehr Zufriedenheit bedeuten. Dafür wäre aber ein höheres Einkommen notwendig. Eine effiziente Kaufentscheidung bedeutet, dass „der Grenznutzen des letzten Cents, der für Cola ausgegeben wird, dem Grenznutzen des letzten Cents entspricht, der für Pizza ausgegeben wird“ (MT, S. 154): In Abbildung 1a) wird „das Konsumentengleichgewicht […] an dem Punkt erreicht, an dem die Budgetlinie die höchste Indifferenzkurve als Tangente berührt“ (SN, S. 166). Allgemeiner formuliert: Rationale Individuen wählen immer genau die Güter beziehungsweise Aktivitäten, die mit den geringsten Opportunitätskosten verbunden sind, das heißt, alle anderen Kombinationen von Gütern und Aktivitäten, die bei gegebenem Zeit- und Geldbudget möglich wären, würden dem Individuum einen geringeren Nutzen stiften.
Irrationalität im Sinne unüberlegten Verhaltens
Dass Menschen in Wirklichkeit nicht immer rational im oben definierten Sinn handeln, geben die Autoren der gegenwärtig dominanten Standardlehrbücher in der Regel unumwunden zu, wenn auch typischerweise erst viele Seiten nachdem der Rationalitätsbegriff eingeführt und auf alle möglichen Lebensbereiche angewendet wurde (siehe den Beitrag von Torsten Heinrich in diesem Band). Samuelson/Nordhaus gestehen ein, dass die Standardtheorie der Nutzenmaximierung so klingt, „als ob Konsumenten mathematische Zauberer wären […]. Wir wissen, dass die meisten Entscheidungen Routineentscheidungen sind und intuitiv getroffen werden.“ (SN, S. 143) Auch Mankiw/Taylor weisen darauf hin, dass „Forschungen belegt [haben], dass unsere Fähigkeit, Urteile zu fällen und Entscheidungen zu treffen, konsistente und systematische Schwachstellen – Befangenheiten – aufweist. […] Statt rational zu sein, können Menschen vergesslich, impulsiv, verwirrt, emotional und kurzsichtig sein. Einige Volkswirte nehmen folglich an, dass Menschen lediglich ‚begrenzte Rationalität‘ aufweisen.“ (MT, S. 171)
Diese Form der Kritik am Homo-oeconomicus-Modell ist verhältnismäßig harmlos. Es ließe sich dagegen einwenden, „dass „[g]erade weil Entscheidungen in ökonomischen Kontexten […] oftmals auf der Basis irrationaler Motive getroffen werden […], eine auf rationale Entscheidungen fokussierte ökonomische Bildung wichtig [ist].“ (Lörwald/Müller 2012, S. 448–449) So ist es sicherlich kein Zufall, dass in den Lehrbüchern von Mankiw/Taylor und Samuelson/Nordhaus gerade solche Abweichungen vom Rationalitätsmodell zugegeben werden, die gemeinhin und insbesondere von den handelnden Individuen selbst im Nachhinein bereut werden, sobald sie sich ihrer irrationalen Entscheidungen („Fehler“) bewusst werden: „Wir wissen, dass Menschen Fehler begehen. Manche kaufen sich unnötigen Schnickschnack, andere werden Opfer skrupelloser Verkaufsmaschen. Ein neuer Forschungsbereich ist die verhaltensorientierte oder behavioristische Ökonomik […] [, die] versucht zu erklären, warum Haushalte zu wenig für die Ruhestandsjahre sparen, warum sich auf Aktienmärkten Spekulationsblasen bilden und wie sich Gebrauchtwarenmärkte verhalten, wenn die Menschen nur über eingeschränkte Informationen verfügen.“ (SN, S. 143–144) Ganz ähnlich bei Mankiw/Taylor (2016, S. 172–145): „Die meisten Menschen sind von ihren eigenen Fähigkeiten zu sehr überzeugt […]. Die Geschichte ihrer Freundin kann sie dazu verleiten, dass sie sie bei ihrer Entscheidungsfindung überproportional bewerten – weil ihre Schilderung so lebhaft war […]. Menschen weisen eine natürliche Tendenz auf, nach Bestätigungen für ihre bestehenden Einstellungen oder Hypothesen zu suchen […]. Menschen [gehen] von Vertrautem oder ihrem Wissen […] [aus]. […] Diese Anker sind nicht neutral und die darauf basierenden Entscheidungen daher fehleranfällig […].“ und so weiter.
Aus diesen Beispielen spricht allerdings keine kritische Hinterfragung des Homo-oeconomicus-Standardmodells, sondern allenfalls der Appell an jeden Einzelnen, weniger Fehler zu machen (zum Beispiel durch einen Kurs in neoklassischer Mikroökonomik oder durch eine private Altersvorsorge).
Die Eigennutz-Annahme
Ein sehr viel grundsätzlicheres Problem liegt in der Frage, wie die Präferenzen von Individuen überhaupt beschaffen sind. Frank/Cartwright (2013, S. 221–222) unterscheiden zwei mögliche Ansätze: Eine erste Definition beschreibt den Homo oeconomicus als eigennützig im engeren Sinne: Er/sie ist in allem, was er/sie tut, um die Verbesserung der eigenen Situation bedacht (diese Annahme treffen auch Mankiw/Taylor 2016, S. 136). Tatsächlich geht menschliches Verhalten in wichtigen Lebensbereichen weit über enge Eigennutzorientierung hinaus: Bei politischen Wahlen nehmen Millionen von Menschen die Opportunitätskosten auf sich, die mit der Fahrt oder dem Gang zur Wahlurne in Form von Zeitverlust und gegebenenfalls Fahrtkosten verbunden sind, obwohl so gut wie ausgeschlossen ist, dass eine einzelne Stimmabgabe die Sitzverteilung im Parlament (und damit zumindest mittelbar die politischen Entscheidungen, von denen ein/e einzelne/r Wähler_in profitieren könnte) beeinflussen wird. Urlauber auf der Durchreise geben Trinkgeld an Kellner_innen, die sie nie wieder sehen werden. Beteiligte an blutigen Familienfehden suchen Rache selbst zum Preis der Selbstauslöschung. Menschen lassen profitable Transaktionen aus, die ihnen unfair erscheinen, und so weiter (FC, S. 222).
Frank/Cartwright (2013) weisen darauf hin, dass viele Vertreter_innen des Rationalwahlmodells in der Tat darauf bestehen, dass der Homo oeconomicus nicht notwendigerweise egoistisch sein muss. Nach dieser Sichtweise, den Frank/Cartwright als „present aim“-Ansatz bezeichnen, ist eine Person dann rational, wenn sie ihre vorhandenen individuellen Ziele, ob egoistischer, altruistischer oder ganz anderer Natur, unter gegebenen Nebenbedingungen auf effiziente Weise verfolgt. Hieraus ergibt sich aber ein schweres empirisches Folgeproblem, das Frank/Cartwright als das „Motoröl-Problem“ bezeichnen: Wenn wir eine Person beobachten, die eine Flasche Motoröl trinkt und daran elendig zugrunde geht, könnten wir dies mit dem „present aim“-Ansatz einfach damit erklären, dass die Person Motoröl wohl wirklich gerne mochte (warum sollte sie es sonst getrunken haben?) (vgl. FC, S. 222). Mit anderen Worten: Ohne die Eigennutz-Annahme oder alternative weitere Annahmen kann mit dem Rationalwahlmodell alles und nichts erklärt werden, es hat also keinerlei Prognosekraft mehr.
Ist nicht-eigennütziges Verhalten ein (evolutorischer) Vorteil?
Frank/Cartwright setzen daher dem „present aim“-Ansatz ein evolutorisches Modell entgegen, in dem nicht-egoistisches Verhalten für alle Mitglieder oder zumindest für einen Teil der Bevölkerung vorteilhaft ist. Hierzu zwei Beispiele.
Erstens: Ein starker Gerechtigkeitsdrang, der mich antreibt, eine andere Person für ein Vergehen zu meinen Lasten zur Rechenschaft zu ziehen, selbst wenn die Kosten hierfür höher sind als die Entschädigung für das Vergehen, kann für mich auf Dauer von (auch materiellem) Vorteil sein, wenn dieses vordergründig uneigennützige und/oder irrationale Verhalten eine abschreckende Wirkung auf weitere potenzielle Übeltäter hat.
Zweitens: Wenn ich den Ruf habe, aus moralischen Gründen unfähig zum Lügen zu sein, selbst wenn eine Lüge zu meinem Vorteil wäre und unbemerkt bliebe, kann mir dies große (auch materielle) Vorteile bringen, weil andere eher bereit sein werden, mit mir (auch ökonomische) Transaktionen einzugehen, die nur dann zum Erfolg führen, wenn alle Beteiligten kooperieren (Vertrauenswürdigkeit als Lösung für nicht-kooperative Spiele).
Für beide Beispiele gilt: Weil es schwer ist, irrationales/uneigennütziges Verhalten gezielt vorzuspielen, können nur echte (nicht kalkulierte) Emotionen hinreichend glaubwürdig und damit (in bestimmten Kontexten) vorteilhaft sein.
Kollektive Vernunft vs. individualistische Rationalität: Ein anderes Verständnis von Knappheit und Effizienz bei positionalen Externalitäten
Frank/Cartwright (2016, S. 512 ff., S. 581 ff.) präsentieren eine weitere Kritik am Standard-Homo-oeconomicus-Modell, die das Rationalität-Axiom betrifft und die bisweilen zum zentralen Bildungsziel erhobene „Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns“ (vgl. den schon genannten Bildungsplan Baden-Württemberg, S. 255) in einem ganz anderem Licht erscheinen lässt. Konsultieren wir hierzu zunächst noch einmal Samuelson/Nordhaus (2013, S. 25): „Unsere Welt ist nach wie vor von Knappheit geprägt […]. Knappheit bedeutet, dass weniger Güter vorhanden sind, als eigentlich erwünscht wären. […] Eine Volkswirtschaft produziert dann effizient, wenn der wirtschaftliche Wohlstand des Einzelnen nicht erhöht werden kann, ohne dass gleichzeitig jemand anders schlechter gestellt wird.“ (SN, S. 25) Fast deckungsgleich ist die Darstellung in Mankiw/Taylor (S. 2).
In diesen Standard-Lehrbüchern ergibt sich die gesellschaftliche Knappheit daraus, dass die einzelnen Individuen jeweils für sich, das heißt unabhängig von sozialer Interaktion, unendliche Bedürfnisse verspüren: „Wenn einige teure Autos kaufen wollen, während andere Wert auf luxuriöse Häuser legen, unterstellen wir, dass sie selbst wissen, was für sie am besten ist, und dass die Regierung ihre Präferenzen im Interesse der persönlichen Freiheit respektieren sollte.“ (SN, S. 151) Kollektiv vereinbarte Einschränkungen individueller Entscheidungen zur Begrenzung externer Effekte werden lediglich in Bezug auf sogenannte demeritorische Güter kurz diskutiert, wobei der Fokus wie in den meisten neoklassisch ausgerichteten Lehrbüchern auf Umweltverschmutzung, Lärmbelästigung und Suchtmitteln liegt (MT, S. 327–328, S. 333 ff.; SN, S. 72–73, S. 151 ff., S. 415 ff.).
Demgegenüber weisen Frank/Cartwright auf die fast banale, aber im Homo-oeconomicus-Standardmodell und in Mankiw/Taylor und Samuelson/Nordhaus weitestgehend vernachlässigte Tatsache hin, dass Menschen sich als soziale Wesen stets mit anderen vergleichen. Die sich hieraus ergebenden positionalen Externalitäten erstrecken sich auf fast alle Konsumgüter und führen dazu, dass die Individuen ihre Zufriedenheit mit bestimmten Gütern daran festmachen, ob sie den jeweiligen Konsumnormen ihrer sozialen Referenzgruppe entsprechen: „Im 19. Jahrhundert fühlte sich niemand benachteiligt, weil er kein Auto oder Fernseher besaß, und trotzdem tendieren Personen, die sich heute solche Geräte nicht leisten können, dazu, darüber sehr unzufrieden zu sein.“ (FC, S. 588)
Ohne positionale Externalitäten steigt die Effizienz und verringert sich die Knappheit, wenn die Versorgung eines Individuums mit einem Gut verbessert wird, ohne dass die Versorgung eines anderen Individuums sich verschlechtert. Für positionale Güter gilt hingegen grundsätzlich, dass der mit ihrer Inanspruchnahme verbundene Nutzen des Einzelnen nicht erhöht werden kann, ohne dass gleichzeitig jemand anders schlechter gestellt wird (durch das Verschieben von Konsumnormen).
In nicht-neoklassischen (zum Beispiel post-keynesianischen) Konsumtheorien hat diese „soziologische“ Perspektive auf individuelle Bedürfnisse eine lange Tradition. So wird beispielsweise in Lavoie (1992) die Relativität individueller Bedürfnisse anschaulich dargestellt (vgl. Abbildung 1b): Wenn Person 1 ihren Konsum ausweitet, steigt zunächst ihre Zufriedenheit, ohne dass die Zufriedenheit anderer Personen (hier: Person 2) beeinträchtigt wird. Im Zeitverlauf wird jedoch die Zufriedenheit von Person 2 mit ihrem bisherigen Konsumniveau fallen, weil sich durch die Besserstellung von Person 1 die Konsumnorm verschoben hat. Wenn schließlich Person 2 nachzieht und ihren Konsum des betreffenden Gutes ebenfalls ausweitet, erhöht sich zwar ihre Zufriedenheit wieder, jene von Person 1 fällt aber auf das Ausgangsniveau zurück.
Frank/Cartwright formulieren diese Zusammenhänge in einer an die neoklassische Gedankenwelt anknüpfungsfähigen Terminologie. So tendieren moderne Gesellschaften laut Frank/Cartwright in vielen wichtigen Lebensbereichen zu „positionalem Wettrüsten“ (FC, S. 583–585). So kann es beispielsweise für viele Familien starke Anreize geben, auf Freizeit, Ersparnisse fürs Alter und eine sinnstiftende, aber finanziell unattraktive Berufswahl zu verzichten, um sich ein Haus in einem „respektablen“ Wohnviertel und eine „gute“ Ausbildung der Kinder leisten zu können. Freizeit, ausreichende Ersparnisse und sinnvolle Arbeit werden zwar von den meisten Menschen ebenfalls wertgeschätzt, sind aber nicht im selben Maße positionale Güter wie der nach außen sichtbare Lebensstandard oder die Karrierechancen der Kinder: „Eine gute Ausbildung ist eine, die besser ist als die Ausbildung, die die meisten anderen erhalten.“ (FC, S. 583, eigene Übersetzung) Wenn sich jedoch alle so verhalten, führt das positionale Wettrüsten dazu, dass zwar alle unter wenig Freizeit, viel Stress, finanzieller Unsicherheit und sinnentleerter Erwerbsarbeit leiden, der durchschnittliche soziale Status sich aber logischerweise nicht verbessert: „Es ist nicht möglich, dass jeder in einer Gesellschaft sich relativ besser stellt.“ (FC, S. 583, eigene Übersetzung)
Ein vernünftiger Umgang mit solchen Formen des positionalen Wettrüstens kann in kollektiven Arbeitszeit- und Arbeitsschutzregelungen, einem starken staatlichen Renten- und Bildungssystem, aber auch in der Eindämmung der Einkommensungleichheit liegen (FC, S. 581–589; Frank 2007; van Treeck 2016). Insbesondere zeigt die ökonomische Glücksforschung regelmäßig, dass das durchschnittliche Wohlbefinden in reichen Gesellschaften nicht durch weitere Steigerung des Pro-Kopf-Konsums erhöht werden kann. Es liegt deshalb nicht nur angesichts der ökologischen Krise nahe, dass vernünftige Menschen kollektive Vereinbarungen treffen sollten, welche das – aus individueller Perspektive vermeintlich rationale – positionale Wettrüsten im Konsum eindämmt.[2]
Welches Menschenbild für die ökonomische Bildung?
Aus meiner Sicht sollte das Homo-oeconomicus-Modell, wie es in Standardlehrbüchern wie Mankiw/Taylor und Samuelson/Nordhaus bisher noch routinemäßig präsentiert wird, für die ökonomische Bildung und Lehre ausgedient haben.
Lörwald/Müller (2012, S. 447) versuchen das Eigennutz-Axiom durch die folgende Klarstellung zu retten: „Die normative Empfehlung lautet […] nicht ‚Verhalte dich wie ein homo oeconomicus!‘, sondern: ‚Konstruiere anreizkompatible Rahmenbedingungen, die selbst gegen Homines oeconomici (sic!) resistent sind!‘“ Das Problem hieran ist unter anderem, dass die Trennung zwischen normativem und empirischem Gehalt der Eigennutz-Annahme überaus schwierig ist. So gibt es klare Anzeichen dafür, dass in der Vergangenheit Studierende im Laufe eines Ökonomie-Studiums egoistischer geworden sind und ihre Fähigkeit zu kooperativem Verhalten verloren haben (FC, S. XXVI; Grant 2013). Weil kooperatives beziehungsweise ethisches Verhalten sowohl für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von großer Bedeutung ist als auch mit systematischen individuellen Vorteilen verbunden sein kann, ist es sehr problematisch, wenn im Schulunterricht oder im Bachelor-Studium das Homo-oeconomicus-Standardmodell zunächst in Reinform präsentiert wird und erst im weiteren Verlauf des Studiums durch (womöglich optionale) Kurse in Verhaltensökonomik ergänzt wird.
Es ist aber ebenfalls problematisch, wie etwa Lörwald/Müller (2012) vorschlagen, lediglich das enge Eigennutz-Axiom fallen zu lassen, aber an der engen Rationalität-Annahme des Homo-oeconomicus-Standardmodells festzuhalten und dieses umso offensiver als Bildungsziel zu propagieren mit dem Argument, dass es die individuellen Problemlösungskompetenzen der Lernenden verbessern kann. Das ist sicherlich für einige Lebensbereiche durchaus zutreffend und wichtig (Frank/Cartwright präsentieren, basierend auf ihrer didaktischen Methode des „economic naturalism“, einige sehr eindringliche alltagsweltliche Beispiele für typische „Fehler“, die mit dem Standard-Rationalitätsmodell entlarvt werden können). Im Kontext von positionalen Externalitäten durch soziale Vergleiche, die in der Realität allgegenwärtig und für zentrale Lebensbereiche prägend sind, ist es aber gerade nicht damit getan beziehungsweise sogar unvernünftig, nach individuellen Lösungen im Umgang mit Knappheit zu suchen.
Die gesellschaftliche Bedingtheit von individuellen Präferenzen ist zwar für die meisten Soziolog_innen und Psycholog_innen eine Selbstverständlichkeit, aber für viele Wirtschaftswissenschaftler_innen sind sogenannte endogene Präferenzen nach wie vor ein rotes Tuch (Stiglitz 2008). Sie sollten aber als integraler Bestandteil eines normativ wie empirisch sinnvollen Menschenbildes verstanden werden. Hierdurch würde der verengte Fokus auf individualistische Problemlösungsansätze, der Mankiw/Taylor und Samuelson/Nordhaus wie den meisten VWL-Lehrbüchern zugrunde liegt, zugunsten von kollektiven, das heißt politischen Handlungsoptionen aufgebrochen.
Literatur
Bildungsplan Baden Württemberg (2015): Bildungsstandards für Wirtschaft im Rahmen des Fächerverbundes Geographie – Wirtschaft – Gemeinschaftskunde Gymnasium – Klassen 6, 8, 10, Kursstufe.
Frank, R.H. (2007): Falling Behind: How Rising Inequality Harms the Middle Class, Berkeley: University Of California Press.
Grant, A. (2013): Does Studying Economics Breed Greed? Even Thinking About Economics Can Make Us Less Compassionate, Psychology Today, 22.10.2013, https://www.psychologytoday.com/blog/give-and-take/201310/does-studying-economics-breed-greed (Zugriff: 10. Mai 2016).
Lavoie, M. (1992): Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis, Cheltenham: Edward Elgar.
Lörwald, D./Müller, C. (2012): Hat das Homo-oeonomicus-Modell ausgedient? Fachdidaktische Implikationen aktueller Forschungen zur ökonomischen Verhaltenstheorie. In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik, Band 108, Heft 3, S. 438–453.
Stiglitz, J.E. (2008): Toward a general theory of consumerism: Reflections on Keynes’ economic possibilities for our grandchildren. In: L. Pecchi/Piga, G. (Hrsg.): Revisiting Keynes: Economic Possibilities for Our Grandchildren, Cambridge: MIT Press, S. 41–86.
van Treeck, T. (2016): Der „große Zwiespalt“ zwischen Effizienz und Gerechtigkeit: Realität oder Ideologie? In: van Treeck, T./Urban, J. (Hrsg.): Wirtschaft neu denken. Blinde Flecken der Lehrbuchökonomie. Berlin: iRights.Media.
[1] Christian Müller war an der Übertragung von Mankiw/Taylor ins Deutsche beteiligt.
[2] Mankiw/Taylor (S. 346) führen zwar auf einer halben Seite in einem Kasten zu „Positionsexternalitäten“ einige Beispiele für positionales Wettrüsten an, gehen aber nicht weiter auf die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen ein.