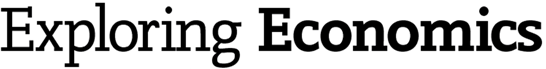Wie steuern wir unsere Wirtschaft?

Foto von Taiki Ishikawa auf Unsplash
Economists for Future, 2023
Wie steuern wir unsere Wirtschaft?
Dirk Ehnts
Erstveröffentlichung im Makronom
Der bisherige Einsatz von Fiskalpolitik, Geldpolitik und Handelspolitik hat zu vielschichtigen Problemen geführt. Um diese zu lösen, müssen wir unsere wirtschaftspolitischen Instrumente anders nutzten. Ein Beitrag von Dirk Ehnts.



![]()
Unsere Gesellschaft befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses. Im Zentrum: die Wirtschaft. Die nächsten Jahre werden entscheiden, ob uns der Wandel by disaster passiert oder uns by design gelingt. Die Debattenreihe Economists for Future widmet sich den damit verbundenen ökonomischen Herausforderungen. Sie beleuchten einerseits kritisch-konstruktiv Engführungen in den Wirtschaftswissenschaften sowie Leerstellen der aktuellen Wirtschaftspolitik. Andererseits diskutieren wir Orientierungspunkte für eine zukunftsfähige Wirtschaft und setzen Impulse für eine plurale Ökonomik, in der sich angemessen mit sozial-ökologischen Notwendigkeiten auseinandergesetzt wird.
Die Makroökonomik ist eine Teildisziplin der Volkswirtschaftslehre, die sich mit der Frage beschäftigt, wie eine Volkswirtschaft gesteuert wird. Traditionelle Ziele sind Vollbeschäftigung und Preisstabilität, die im 21. Jahrhundert durch das übergeordnete Ziel des nachhaltigen Umgangs mit natürlichen Ressourcen ergänzt werden.
Der bisherige Einsatz der wirtschaftspolitischen Instrumente der Fiskalpolitik (Kürzungen der Staatsausgaben, Steuersenkungen für höhere Einkommen und Unternehmen), der Geldpolitik (Zinserhöhungen der EZB) und der Handelspolitik hat zu Problemen geführt, die uns seit Jahrzehnten begleiten und heute besonders präsent sind: wachsende Ungleichheit, Massenarbeitslosigkeit, Klimawandel, zu hoher Ressourcenverbrauch. Um diese Probleme zu lösen, müssen wir unsere wirtschaftspolitischen Instrumente anders einsetzen. Nur dann können wir hoffen, die damit verbundene gesellschaftliche Transformation in Gang zu setzen.
Private und öffentliche Unternehmen produzieren, was wir kaufen. Unternehmen produzieren nur, wenn sie glauben, ihre Produktion absetzen zu können – ohne Absatz kein Gewinn. Unternehmen müssen in finanzielle Vorleistung gehen, da sie in der Regel erst ihre Produktionsmittel beschaffen müssen, bevor sie ihre Produkte verkaufen – die Produktion braucht Zeit. Viele Unternehmen leihen sich daher Geld, um überhaupt produzieren zu können. Für diese Kredite müssen sie wiederum Zinsen zahlen, weswegen Gewinne für den dauerhaften Betrieb privater Unternehmen notwendig sind. Wenn Unternehmen keinen dauerhaften Gewinn erwirtschaften können, verschwinden sie vom Markt. Auf diese Weise werden Güter und Dienstleistungen für den Konsum der Gesellschaft bereitgestellt.
Auch der Staat kann Güter und Dienstleistungen produzieren. Er kann diese entweder selbst herstellen oder sie von privaten Unternehmen erwerben, die diese andernfalls nicht herstellen würden. Adam Smith befürwortete die Bereitstellung von Bildungsdienstleistungen durch den Staat, da sich nicht alle Bürger*innen einen privaten Schulbesuch für ihre Kinder leisten könnten. Schulen sind daher staatlich organisiert, wobei der Staat das Gemeinwohl seiner Bürger*innen im Blick hat und nicht nach Gewinnmaximierung strebt. So ist der Besuch einer öffentlichen Schule in Deutschland kostenlos.
Staatliche Ausgaben und Geldschöpfung
Neben den beiden genannten Produktionsweisen existiert auch die Produktion in Haushalten, die Care-Arbeit. Da diese jedoch unbezahlt ist, wird sie weder im Konsumentenpreisindex berücksichtigt, noch als Beschäftigung gezählt. In einer industrialisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts gibt es also im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, Güter und Dienstleistungen am Markt zu produzieren: Entweder produzieren private Unternehmen oder der Staat produziert selbst.
Dabei schöpft der Staat sein eigenes Geld über die staatliche Zentralbank, die Deutsche Bundesbank. Die Zentralbank wiederum ist für die Geldschöpfung im Eurosystem verantwortlich, wie es auch von Christine Lagarde bestätigt wurde. Dieses System setzt sich aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Zentralbanken (NZB) zusammen. Die Währung wird digital hergestellt, weshalb das Geldsystem wie ein Punktestand im Computer funktioniert. Genau wie die Buchstaben, aus denen dieser Text besteht, wird auch das Guthaben auf unseren Konten bei den Banken durch den Computer erzeugt. Es handelt sich also um Einträge in digitalen Kontensystemen, die von Banken und Zentralbanken verwaltet werden.
Eine zentrale Einsicht ist, dass der Bund im Gegensatz zu privaten Haushalten und Unternehmen Zahlungen tätigen kann, ohne vorher „Geld” zu haben. Es wird durch die Bundesbank bei der Ausgabe erzeugt und bei Steuerzahlungen entsprechend wieder vernichtet. Die Vorstellung, dass die Steuerzahler*innen den Staat finanzieren, ist somit falsch. Alle Zahlungen der Bundesregierung werden durch die Schaffung von neuem digitalem Geld in Form von Bankguthaben bei der Zentralbank ausgeführt. Der Staat ist also mit seinen Ausgaben ein sehr wichtiger Faktor, weil er die Nachfrage nach Gütern und damit Produktion und Beschäftigung verändert.
Welche Art der Wirtschaftslenkung brauchen wir?
Erfahrungen aus der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre und der Großen Finanzkrise von 2008/09 haben deutlich gemacht, dass der Staat die Wirtschaft mithilfe seiner Ausgaben steuern muss. Es gibt keine Tendenzen, die zu einer „Selbstregulierung“ der Wirtschaft führen würden. Eine Wirtschaft erreicht weder Vollbeschäftigung noch Preisstabilität aus eigener Kraft. Ein nachhaltiges Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Energie, Wasser, usw.) kann nur durch staatliches Eingreifen erreicht werden.
Wenn die Wirtschaft Ziele wie Vollbeschäftigung, Preisstabilität und nachhaltiges Wirtschaften nicht aus sich selbst heraus erreicht, wie müssen dann wirtschaftspolitische Instrumente aussehen und eingesetzt werden? Derzeit herrscht unter Wirtschaftspolitiker*innen der Konsens, dass der Zentralbank die Verantwortung für die Inflationsrate übertragen wird und der Staat mit seiner Fiskalpolitik (Staatsausgaben und Steuersystem) eine passive Rolle spielt. Die EZB hat ein festgelegtes Inflationsziel von zwei Prozent und nutzt hierfür einige selbst bestimmte Zinssätze als Instrument. Diese bilden die Basis der Kreditzinsen für Banken, die Haushalten und Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.
Der aktuelle Konsens ist, dass höhere Zinsen der EZB dazu führen, dass sich private Investitionen weniger lohnen. Dies würde zu einer Senkung der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen sowie nach Arbeit führen. Des Weiteren würde der Druck auf Preise und Löhne abnehmen und die Inflationsrate zurückgehen.
Allerdings würde dies auch zu einem unerwünschten Anstieg der Arbeitslosigkeit führen, also ein Teil der Gesellschaft infolge der Verfolgung der Preisstabilität in die Arbeitslosigkeit geschickt. Der US-Ökonom Larry Summers schlug der gegenwärtigen US-Regierung genau diese Maßnahmen vor, unter der Annahme, dass zu hohe Ausgaben der Treiber der erhöhten Inflationsraten sind.
Die Regierung setzt allerdings auf „Bidenomics“, eine alternative Wirtschaftspolitik. Im Gegensatz zu Summers identifizieren die Ökonom*innen der Biden-Regierung wie auch viele ihrer Kolleg*innen die erhöhten Energiepreise als den wahren Grund für die erhöhten Inflationsraten. Entsprechend waren die Zinserhöhungen in den USA und anderswo bisher weitgehend wirkungslos. Obwohl sie laut aktuellem Konsens zu einer höheren Arbeitslosigkeit führen sollten, ist das Resultat aktuell eine Rekordbeschäftigung. Ein möglicher Crash auf dem US-Immobilienmarkt wäre kein wirtschaftspolitischer Erfolg, sondern würde große neue Probleme schaffen. Vermutlich wären die Energiepreise auch ohne Zinserhöhungen gesunken, wie das Beispiel Japans zeigt, wo die Zentralbank die Zinsen nicht erhöht hat.
Gleichzeitig verabschiedeten sie sich von der Idee des „trickle-down growth”, also der Vorstellung, dass Steuererleichterungen für Reiche zu mehr Investitionen und damit zu mehr Beschäftigung, höherer Produktivität und mehr Produktion führen. Diese Ergebnisse sind jedoch weder in den USA noch in Deutschland, wo die Steuererleichterungen der rot-grünen Bundesregierung der Jahrtausendwende nicht die erhofften Ergebnisse brachten, eingetreten. Die Regierung Biden verwendet die Staatsausgaben stattdessen für grüne Investitionen, die zugleich gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze schaffen und das Ziel der Vollbeschäftigung erreichen sollen. Dabei setzt sie auf „crowding-in“ (Aktivierung), denn wenn der Staat seine Ausgaben erhöht, müssen private Unternehmen investieren, um staatliche Aufträge erhalten zu können.
Wirtschaftstheorie für das 21. Jahrhundert
Derzeit beobachten wir in den USA eine neue Wirtschaftspolitik, die Staatsausgaben einsetzt, um Nachhaltigkeit, Preisstabilität und Vollbeschäftigung zu erreichen. Durch grüne Investitionen, wie zum Beispiel in Hochgeschwindigkeitszüge, Elektroautos und Solaranlagen, unterstützt die US-Regierung private Unternehmen bei der Umrüstung ihrer Produktion. Auch wenn die Programme noch nicht groß genug sind, ist dies ein wichtiger Fortschritt. Die Obergrenze für zusätzliche Staatsausgaben liegt in der Beschränkung der Ressourcen und Arbeitskräfte. Zum einen entzieht der Staat durch seine Ausgaben dem privaten Sektor diese Ressourcen, was die Produktion von Konsumgütern voraussichtlich reduziert. Zum anderen kann der Staat nur das kaufen, was ihm seine Unternehmen und BürgerInnen verkaufen, und das ist nun mal begrenzt.
Eine Umsetzung der US-amerikanischen Wirtschaftspolitik in der Eurozone wäre derzeit schwierig, da den nationalen Regierungen enge Defizitgrenzen gesetzt sind, die nur bis Ende dieses Jahres ausgesetzt wurden. Sollten die Staatsausgaben nach Abzug der Steuereinnahmen drei Prozent des BIP übersteigen, müsste nach den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts ein Defizitverfahren eingeleitet werden, das zu Kürzungen der Staatsausgaben führen würde. Hier stehen bestehende Institutionen einer modernen Wirtschaftspolitik im Wege, insbesondere hinsichtlich grüner öffentlicher Investitionen. So argumentiert selbst das arbeitgeberfinanzierte Institut der Wirtschaft (IW) gerade gegen die nationale Schuldenbremse, die diese notwendigen öffentlichen Investitionen verhindert.
Eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik sollte so ausgerichtet sein, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit höchste Priorität und Vorrang vor anderen Zielen wie Vollbeschäftigung oder Preisstabilität hat, und diese nicht gegeneinander ausgespielt werden. Dazu sollte das Ziel der Vollbeschäftigung mit Hilfe von Fiskalpolitik, also über eine Variation der Staatsausgaben, verfolgt werden.
Dabei ist aber stets auch die Preisstabilität zu berücksichtigen. Wenn der Staat knappe Ressourcen benötigt, können selbst geringe Erhöhungen der Staatsausgaben stark inflationär wirken. Wie Isabella Weber deutlich macht, sollte der Staat dort lenkend in die Preisgestaltung eingreifen, wo Marktergebnisse nicht akzeptabel sind. Eine derartige Wirtschaftspolitik ist wesentlich besser geeignet, die Ziele Vollbeschäftigung, Preisstabilität und nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung zu erreichen, als eine weitere Fokussierung auf die weitgehend wirkungslosen Zentralbankzinsen bei gleichzeitiger Vernachlässigung der Fiskalpolitik.
Zum Autor:
Dirk Ehnts ist Vorstandssprecher der Samuel-Pufendorf-Gesellschaft für politische Ökonomie. Er beschäftigt sich in der Forschung schwerpunktmäßig mit monetärer Geldtheorie, Makroökonomik, pluraler Ökonomik und Finanzmärkten.