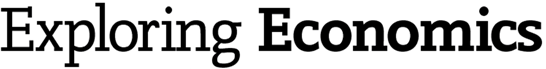Endlich reden wir wieder über Arbeitszeitverkürzung
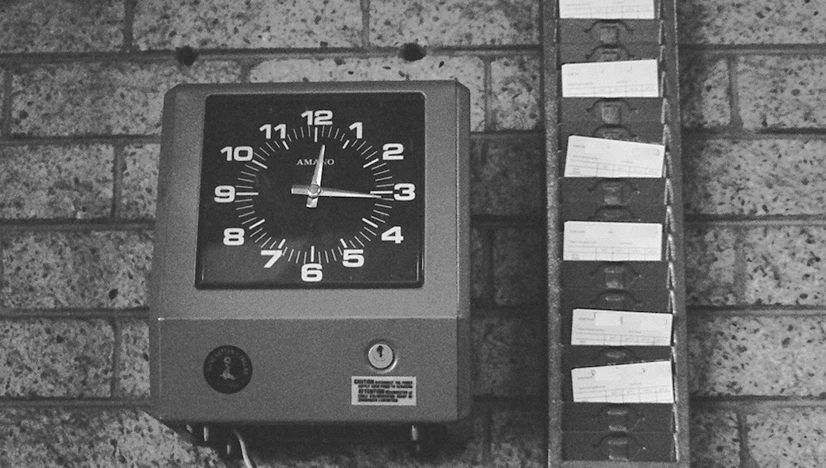
Foto von Hennie Stander auf Unsplash
Netzwerk Plurale Ökonomik, 2024
„Wir machen uns nicht mehr kaputt“, titelte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel vergangenes Jahr. Die Titelstory erzählt ein derzeit allgemein beliebtes Thema: Generation Z und ihre Einstellung zur Erwerbsarbeit.
Aber nicht nur individuelle oder generationenspezifische Ideen von Lohnarbeit sind in der Öffentlichkeit gerade überall präsent, die Debatte um Lohnarbeitszeitverkürzung hat (endlich) an Fahrt aufgenommen. Die Lokführergewerkschaft GDL war mit ihrer Forderung nach der 35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich zuletzt erfolgreich und auch andere einflussreiche(re) Gewerkschaften wie die Verdi und die IG Metall setzen sich vehementer dafür ein, mehr Zeit für Beschäftigte zu erstreiten.
Die Erwerbstätigen in Deutschland wollen heute weniger arbeiten als je zuvor. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung liegt die Wunscharbeitszeit bei 32,8 Stunden pro Woche. Dafür würden die Beschäftigten auch in Kauf nehmen, weniger zu verdienen. Neben diesen individuellen Gründen sprechen auch viele gesellschaftspolitische Faktoren für eine Arbeitszeitverkürzung. Schauen wir uns vier davon einmal näher an.


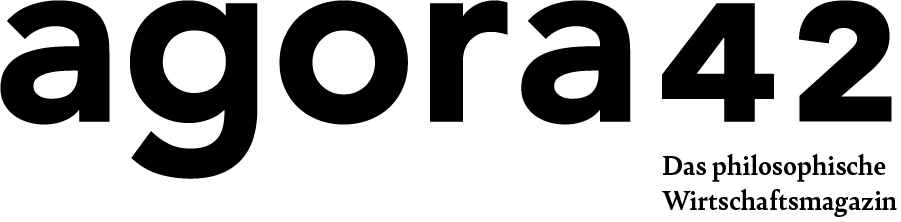
Dieser Artikel wurde auf Agora42 erstveröffentlicht.
In der Kolumne Jenseits von Angebot und Nachfrage nehmen Autor*innen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik die fachlichen Scheuklappen der Lehrbuchökonomie ab und werfen einen pluralökonomischen Blick auf gesellschaftspolitische Fragestellungen.
#1 Weniger Stress spart Geld
Die Anforderungen an Erwerbstätige sind in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen – die Arbeit ist oft stark verdichtet, der Zeitdruck groß und die vorausgesetzten Fähigkeiten umfangreich. Mit Folgen: 2020 haben sich ein Viertel der Erwerbstätigen psychischen Belastungen ausgesetzt gefühlt. (destatis.de) Die Krankenkassen veröffentlichen regelmäßig Gesundheitsberichte, die dokumentieren, dass sich immer mehr Menschen wegen psychischer Probleme krankschreiben lassen. Die AOK verzeichnete beispielsweise in den vergangenen zehn Jahren 48 Prozent mehr solcher Krankschreibungen. (aok.de)
Diese Arbeitsausfälle sind teuer: Die mit psychischen Erkrankungen verbundenen Kosten belaufen sich jedes Jahr auf Milliardenbeträge. Ein Bericht der OECD schätzt diese Summe in Deutschland auf 4,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – wohlgemerkt stammt diese Hochrechnung aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. (oecd.org) Ein beträchtlicher Teil dieser psychischen Erkrankungen, die durch Stress verursacht werden, wäre wahrscheinlich vermeidbar, wenn die Erwerbsarbeitszeiten reduziert würden.
#2 Wer weniger arbeitet, schützt das Klima
Weniger zu arbeiten, könnte aber auch dem Klimaschutz guttun: Juliet Schor, Wirtschaftswissenschaftlerin und Soziologieprofessorin am Boston College in den USA, fand einen deutlichen Zusammenhang zwischen Arbeitszeiten und der Klimabilanz heraus, insbesondere in wohlhabenden Staaten. Vergleichende Studien aus verschiedenen Ländern zeigen, dass eine reduzierte Erwerbsarbeitszeit zu signifikanten CO2-Einsparungen führen kann. Schon einen Tag in der Woche weniger zu arbeiten, könnte den Energieverbrauch am Arbeitsplatz deutlich senken, der Pendelverkehr würde abnehmen und insgesamt könnte es die Menschen zu einem nachhaltigeren Lebensstil anregen– denn ein klimafreundliches Leben braucht Zeitreichtum. Pilotprojekte in Großbritannien, den USA und Irland zeigten, dass eine Vier-Tage-Woche nicht nur die Produktivität steigern und die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen kann, sondern auch den CO2-Ausstoß durch verringerten Pendelverkehr senken könnte.
Bei all dem ist zu bedenken, dass es auch zu sogenannten Rebound-Effekten kommen könnte. Diese treten beispielsweise ein, wenn Menschen mehr konsumieren oder eher übers Wochenende mit dem Flugzeug verreisen, wenn sie mehr Freizeit zur Verfügung haben. Die CO2-Einsparungen durch die verringerte Arbeitszeit würden dadurch wieder verpuffen. Die genannte Pilotstudie hat allerdings ergeben, dass Menschen die gewonnene Freizeit meist mit CO2-armen Aktivitäten wie Hobbys und Hausarbeit verbringen. Klar ist: Wir brauchen dringend mehr Forschung, vor allem zu den Auswirkungen von möglichen Rebound-Effekten.
#3 Weniger Erwerbsarbeit kann den Arbeitskräftemangel reduzieren
Die Wochenarbeitszeit zu reduzieren, könnte auch ein anderes Problem lösen: Bessere Arbeitsbedingungen – die 4-Tage-Woche, flexible Arbeitszeiten und gute Löhne – können dazu beitragen, Jobs attraktiver zu machen und so den allgemeinen Arbeitskräftemangel zu verringern. Immer mehr Arbeit kann nicht die Antwort auf den Mangel an Arbeitskräften sein. Das wäre keine nachhaltige Lösung.
Es gibt in Deutschland, aber vor allem im Ausland, noch viel ungenutztes Potenzial für den Arbeitsmarkt. Statt Konzepte zu entwickeln, wie man die Berufstätigen dazu bringt, mehr und länger zu arbeiten, könnten Strategien entwickelt werden, Deutschland zu einem Einwanderungsland zu machen, das diesen Namen auch verdient. Denn immer noch sind die Hürden für die Einreise, aber vor allem die Anerkennung von Abschlüssen und Anforderungen beim Spracherwerb viel zu hoch, die bürokratischen Prozesse viel zu langwierig. Außerdem ist die deutsche Gesellschaft geprägt durch ein negatives Bild von Migration und allgegenwärtigen Alltagsrassismus. In der Presse muss man lange suchen, bis man auf einen positiven Beitrag über Migration stößt.
#4 Ohne weniger Lohnarbeit keine Gleichstellung der Geschlechter
Weniger Erwerbsarbeit wird nicht automatisch zu mehr Gleichberechtigung führen. Dieses Ziel ist auch weiterhin nur mit einem tiefgreifenden soziokulturellen Wandel erreichbar. Aber eines ist klar: Ohne weniger Lohnarbeit kann es keine Gleichstellung der Geschlechter geben. Der entscheidende Faktor ist hier immer noch die Carearbeit, also alle Tätigkeiten des Sich-Kümmerns und Füreinander-Daseins, die größtenteils von Frauen geleistet werden. Der sogenannte „Gender Care Gap“ beträgt momentan 44,3 Prozent. Das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 44,3 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 79 Minuten Unterschied pro Tag. So verbringen Männer pro Woche knapp 21 Stunden und Frauen knapp 30 Stunden mit unbezahlter Sorgearbeit. Studien zeigen deutlich, dass es in den allermeisten Fällen (in Hetero-Beiziehungen) mit einer gleichberechtigten Aufteilung von Lohn- und Carearbeit vorbei ist, sobald die Paare Kinder bekommen. Der „Gender Care Gap“ erreicht in der Altersgruppe der 34-Jährigen seinen Höhepunkt. Frauen widmen sich in diesem Alter im Durchschnitt fast neun Stunden täglich unbezahlter Sorgearbeit, während Männer nur etwa drei Stunden dafür aufbringen. Das entspricht einem „Gender Care Gap“ von sage und schreibe etwa 170 Prozent.
Für Frauen bedeutet das kleinere Einkommen, ein geringeres Vermögen, weniger Freizeit, wesentlich mehr mental load – also Stress, der durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht – und häufig genug Altersarmut. Die Reduzierung von Erwerbsarbeit ist sicherlich keine hinreichende Bedingung für die Gleichstellung der Geschlechter, aber eine notwendige.
Nun argumentieren einige: Es könnten ja einfach alle 40 Stunden die Woche arbeiten. Das entspricht allerdings nicht der Lebensrealität der Menschen: Die Hälfte der Frauen in Deutschland ist teilzeitbeschäftigt. Und die meisten Vollzeit-Berufstätigen wollen weniger arbeiten – oft nicht 20 Stunden, aber vielleicht 30 oder 32 Stunden die Woche.
Fazit: Die Ablenkungsmanöver überzeugen nicht
Es gibt also viele gute gesellschaftspolitische Gründe für eine Reduzierung der allgemeinen Erwerbsarbeitszeit. Gleichzeitig werden vor dem Hintergrund des steigenden Arbeitskräftemangels und des Renteneintritts der Babyboomer an allen Ecken und Enden Horrorszenarien ausgemalt: Die Sozialsysteme könnten zusammenbrechen oder die Faulheit der Jugend bedrohe unseren Wohlstand, heißt es dann oft.
Häufig wird ein knallharter Generationenkonflikt zwischen Babyboomern auf der einen Seite und Generation Z auf der anderen Seite heraufbeschworen, um individuelle Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung zu problematisieren. Generation Z sei faul und hedonistisch, ist hier die Kernthese. Geht es hingegen um die kollektiven Forderungen der Gewerkschaften, ist das Gegenargument des bereits bestehenden Fachkräftemangels wohl am beliebtesten. Beide Argumente überzeugen bei näherem Hinsehen nicht.
Der Arbeitskräftemangel lässt sich nachhaltig und zufriedenstellend nur durch Zuwanderung reduzieren – denn die Erwerbstätigen in Deutschland wollen nicht mehr arbeiten. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele Menschen, die gerne zum Arbeiten nach Deutschland kommen würden. Die grundlegende Idee des Arbeitskampfes ist, dass Produktivitätszuwächse in Geld oder eben Zeit für arbeitende Menschen umgewandelt werden sollten, anstatt in Profite für Besitzende. Diese Idee als individuelle Wohlfühlforderung einer angeblich arbeitsscheuen Jugend darzustellen, ist ein Ablenkungsmanöver. Es geht hier nicht um Einzelinteressen einer bestimmten Gruppe. Es geht um nicht weniger als eine politische Utopie, die Lust auf die Zukunft macht. Es geht um das gute Leben für Millionen Menschen, die in Deutschland acht Stunden am Tag am Fließband oder an der Kasse stehen, vor Bildschirmen sitzen oder ihre Mitmenschen pflegen.

Lina Andres, geboren 1995 in Berlin-Neukölln, gehört knapp noch zur Generation Z. Sie hat Internationale Beziehungen und VWL studiert und interessiert sich für feministische Ökonomie und Vermögensungleichheit. Hauptberuflich arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag.