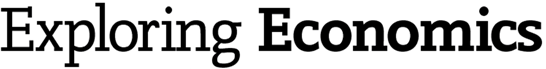Ein echter Green New Deal sollte auch die Demokratie stärken
Economists for Future, 2019




Im Angesicht der Klimakrise und der Fridays-for-Future-Proteste hat das Netzwerk Plurale Ökonomik unter #Economists4Future dazu aufgerufen, Impulse für neues ökonomisches Denken zu setzen und bislang wenig beachtete Aspekte der Klimaschutzdebatte in den Fokus zu rücken. Dabei geht es beispielsweise um den Umgang mit Unsicherheiten und Komplexität sowie um Existenzgrundlagen und soziale Konflikte. Außerdem werden vielfältige Wege hin zu einer klimafreundlichen Wirtschaftsweise diskutiert – unter anderem Konzepte eines europäischen Green New Deals oder Ansätze einer Postwachstumsökonomie. Hier finden Sie alle Beiträge, die im Rahmen der Serie erschienen sind.
Ein echter Green New Deal sollte auch die Demokratie stärken
Janina Urban
Erstveröffentlichung im Makronom
Bei der Klimafrage müssen nicht nur ökologische, sondern auch gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Denn ein dauerhaftes Makromanagement, das die Natur zwar preislich abbilden kann, dessen Richtungsbestimmung aber privatisiert bleibt, wird weder das Klima noch die Demokratie retten.
Man darf wohl behaupten, dass die Idee eines „Green New Deal“, also einer Investitionsoffensive, die den ökologischen Umbau der Wirtschaft zum Ziel hat, lange Zeit vor allem vom progressiven Spektrum vorangetrieben wurde. Doch je wärmer das Weltklima wird, desto mehr können sich offenbar auch eher konservative Wähler*innen und Parteien für diese Idee erwärmen.
Diese Entwicklung gibt dem Konzept aber auch eine gewisse Beliebigkeit. Tatsächlich können die Reichweite und Stoßrichtung der konkreten Pläne erheblich variieren, wie ich in diesem Beitrag anhand von zwei Vorschlägen eines Green New Deals aufzeigen möchte: zum einen die Pläne der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ihn als zentrales europäisches Regierungsprojekt versteht, und zum anderen den Alternativvorschlag einer Allianz von zivilgesellschaftlichen Initiativen.
Da es zwischen den Plänen durchaus Überschneidungen gibt, bleibt es nicht aus, die Höhe der Mittel, die in einen ökologischen Umbau fließen müssten, zu diskutieren. Allen voran möchte ich aber auch die Art und Weise, wie politisch abgestimmt und investiert wird, miteinander vergleichen. Denn sollten in den nächsten Jahren größere Summen in die europäischen Länder fließen, besteht die Möglichkeit, durch verschiedene institutionelle Designs der Unternehmensformen und Entscheidungsstrukturen herauszufinden, welche Methode am umweltfreundlichsten ist und Arbeitnehmer*innen am ehesten an diesem Prozess beteiligt. Letzteres Ziel ist deshalb Teil der Überlegungen, da der gemeinsame Währungsraum auch eine Absicherung des Faktors Arbeit braucht.
Der Green Deal der EU-Kommission
Ursula von der Leyen präsentierte in ihrer Antrittsrede mit dem „Green Deal” eine große Zahl und einige Regulierungsvorstöße: Eine Billion Euro soll in den kommenden zehn Jahren in den ökologischen Umbau fließen, die Emissionsfreiheit bis 2050 erreicht, der Flugverkehr höher besteuert und Importe an der Grenze der EU nach ihren Emissionen belastet werden (die sogenannte CO2- Grenzsteuer). Die eine Billion Euro soll wiederum nicht aus Steuern finanziert werden, sondern über die sich im öffentlichen Besitz befindliche Europäische Investitionsbank (EIB), die Kredite vergeben und Anlagemöglichkeiten schaffen soll.
Der Grundgedanke hinter dieser Finanzierungsvariante ist, dass Unternehmen und öffentliche Träger durch ihre Kreditaufnahme neue, umweltfreundlichere Infrastrukturen schaffen sowie alte überholen können, was ihnen ohne die Kredite nicht in diesem Maße möglich wäre. So ließe sich auch vermeiden, dass die Privatwirtschaft nicht einfach nur eine günstigere Finanzierung erhält, als dies bei einer normalen Finanzierung über Geschäftsbanken der Fall wäre (Crowding Out) – jedenfalls unter der Voraussetzung, dass ihre Investitionen einem umweltfreundlichen und gegebenenfalls auch demokratiefördernden Zweck dienen und das Ganze in einen längerfristigen politischen Plan eingefasst ist. Mit diesen Investitionen könnten also neue Standards gesetzt und Regulierungen getestet werden.
Der Investitionsplan zielt zudem darauf an, Finanzmittel anders und gesellschaftsdienlicher zu kanalisieren. So kritisieren nicht wenige Ökonom*innen, dass der Finanzsektor momentan dazu beiträgt, dass in bestimmte wenig nachhaltige Bereiche investiert wird und dort die Preise nach oben getrieben werden, z. B. im Wohnungssektors, den fossilen Energien und der Rüstung. In all diesen Bereichen hat diese Spekulation negative Auswirkungen: teils drastisch steigende Mieten, an fossilen Energieträgern wird festgehalten oder internationalen Konflikte befördert, während das Geld für eine zielstrebige und sozial gerechte Klimapolitik fehlt.
Ist der vorgeschlagene Green Deal der Kommission nun wirklich ein Plan, bei dem alle gewinnen? Dazu müssen wir auf die aktuelle sozial-ökologische Bilanz der Europäischen Union schauen. In der EU beträgt der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro Kopf 8,7 Tonnen (Deutschland liegt mit 11,4 Tonnen an der Spitze dieses Rankings). Der durchschnittliche Anteil Erneuerbarer Energien liegt bei 17%, variiert aber stark: von 6% in den Niederlanden und 9% in Großbritannien bis hin zu 54% in Schweden und 37% in Finnland. Deutschland liegt mit 15% im hinteren Feld.*
Wir leben zwar in multiethnischen Gesellschaften und können überall arbeiten, aber nur schwerlich überall demokratisch mitbestimmen
Um die angestrebte Emissionsfreiheit im Jahr 2050 zu erreichen, müssten die aktuellen CO2-Reduktionspläne in der simpelsten Rechnung eine Verdreifachung der Anstrengungen beinhalten und die Ausbaugeschwindigkeit der Erneuerbaren beibehalten werden – allerdings verläuft ein solcher Umbau nicht linear, sondern erfordert an vielen Stellen eine völlig neue Infrastruktur an Netzen, Speichermöglichkeiten, Steuerung etc. Dabei sind letztere nicht nur technische Fragen, sondern könnten beispielsweise die Erkrankungsrate durch Luftverschmutzung deutlich senken oder die Akzeptanz von Erneuerbaren durch Formen der ökonomischen und politischen Beteiligung erhöhen.
Während die Regierungen bei der Emissionsfreiheit und dem Anteil der Erneuerbaren auf das Jahr 2050 bestehen, drängen Fridays for Future und internationale Organisationen in Anbetracht der schon jetzt spürbaren Folgen des Klimawandels auf das Zieljahr 2035. Hieraus sollte deutlich werden, was nun die von von der Leyen vorgeschlagene eine Billion Euro auf zehn Jahre bewirken würde: gerade einmal 0,63% des Bruttoinlandsprodukts jährlich würde in den ökologischen Umbau investiert. Dies klingt wiederum nicht nach einem Green New Deal, der diesen Namen verdient hätte.
Große Pläne in Zeiten des Rechtspopulismus
„Wir machen nichts Ideologisches, wir machen etwas, für das es massive Evidenzen gibt.“ Diese Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Präsentation des deutschen Klimapaktes am 20. September sorgte für Aufsehen, während der Pakt in weiten Teilen der Bevölkerung große Enttäuschung auslöste – nicht wenige hatten den Eindruck, dass sich die Regierung eher an den von Rechtspopulisten geschürten Ängsten als an den Forderungen von Millionen von Demonstranten orientiert hatte.
Damit ist das Umfeld beschrieben, in welchem sich die Politik momentan bewegt – bei der Klimafrage müssen also nicht nur ökologische, sondern auch gesellschaftliche Aspekte mit berücksichtigt werden.
Es lohnt sich deshalb, einen kleinen Umweg zu verschiedenen Erklärungen des weltweit erstarkenden (Rechts-)Populismus zu machen. Dabei bleiben die häufig gehörten Ansätze für sich genommen unzureichend, wie etwa jener, dass die Sozialdemokratie die Arbeiterklasse aufgegeben hat, oder dass entfesselte Marktkräfte zu Gegenbewegungen führen, die den Schutz vor jenen marktliberalen Kräften einfordern (etwa nach Karl Polanyi).
Wie zum Beispiel Cornelia Koppetsch zeigt, wählen in Deutschland nicht nur sogenannte „Globalisierungsverlier*innen“ die AfD. Vielmehr zieht sich der rechtspopulistische Schnitt durch alle Einkommensschichten, lässt sich aber in einem bereits konservativ orientierten Milieu, inklusive der Mittelschicht, verorten. Während Koppetsch allerdings über das höhere soziale Kapital der international mobilen Gruppen spricht, gegen das sich Rechtspopulist*innen öffentlichkeitswirksam zu Wehr setzen, halte ich persönlich die Erklärungen des Populismus als eine Formkrise der Demokratie für gehaltvoller. Der Politikwissenschaftler Yascha Mounk formuliert treffend:
„Früheren Generationen mag es natürlich erschienen sein, dass das Volk seine Vertreter nur alle vier Jahre bestimmt und für dieses Privileg höchstpersönlich im Wahllokal vorstellig werden muss. Einer Generation, die mit den digitalen, plebiszitären und unmittelbaren Popularitätswettbewerben auf Twitter und Facebook, sowie bei Big Brother und Deutschland sucht den Superstar aufgewachsen ist, erscheinen diese Institutionen dagegen außerordentlich schwerfällig.”
Mounk erklärt das aktuelle Dilemma der liberalen Demokratie damit, dass sie auf einem Kompromiss beruht, der die Interessen des Volkes eher bändigen als vertreten soll, und dass die Demokratie sich in den letzten Jahrzehnten kaum weiterentwickelt hat, um die Veränderungen in der Wirtschaft und die gestiegene Mobilität der Menschen abzubilden – wir leben zwar in multiethnischen Gesellschaften und können überall arbeiten, aber nur schwerlich überall demokratisch mitbestimmen. Zentralbanken, Gerichte und internationale Verträge haben an Bedeutung gegenüber nationalen Parlamenten gewonnen, während Parlamentsentscheiden wie im Falle Griechenlands in der Eurokrise nicht gefolgt oder die Einschränkung von Grundrechten in Ungarn nicht geahndet werden.
Rechtspopulist*innen kritisieren in der Regel (nur) vorletzteres. Dies zeigt schon, dass Populismus nicht gleich Populismus ist. So lässt sich dem Rechtswissenschaftler Kolja Möller zufolge ein autoritärer von einem demokratischen Populismus unterscheiden: ersterer bezweckt eine enger werdende Definition, wer zum Volk dazu gehört, während zweiterer eine Öffnung der zu Repräsentierenden beinhaltet.
Eine Zunahme der wirtschaftlich relevanten, nicht-parlamentarischen Institutionen kann aber auch als Ergebnis einer liberalen Demokratie verstanden werden, die sich auf dem Ausschluss der politischen Entscheidungen über wirtschaftliche Geschäfte begründet. Eine soziale Demokratie basiert auf der Festlegung von Mitbestimmung auf allen politischen Ebenen wie auch im wirtschaftlichen Bereich. Fernab davon, nur auf der regionalen Ebene aufzuscheinen, können soziale (wie auch liberale) Rechte der internationalen Ebene ein Korrektiv für die nationalen Entwicklungen darstellen. Eine Diskussion darüber, wie eine Weiterentwicklung der Demokratie vorangetrieben werden kann, scheint also vor der Folie des Rechtspopulismus auch in Bezug auf einen Green New Deal relevant.
#NotAnotherJuncker – ein anderer Green New Deal ist möglich
Der von Ursula von der Leyen verkündete Green Deal würde wohl nicht mit solch gesteigerten Erwartungen diskutiert werden, wenn er nicht in die Zeit größerer sozialer Bewegungen und der Bilanz des vorherigen europäischen Investitionsprogramms, dem „Juncker-Plan“, fallen würde.
Der Juncker-Plan wurde 2015 mit der Motivation gestartet, den Investitionsstau infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise in der EU abzumildern. Nach heutigem Stand (September 2019) wurden 433 Milliarden Euro über die Europäische Investitionsbank mobilisiert und faktisch 80 Milliarden Euro an Förderungen und Garantien ausgegeben. 30% der Kredite wurde von kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie Aktiengesellschaften mit mittelhohem Börsenwert genutzt, 26% gingen in Forschung und Entwicklung, 18% in den Energiesektor, 7% in den Transport und 4% in Umwelt- und Ressourceneffizienz. Der Juncker-Plan hatte wenige Elemente, die mit einer Veränderung der bisherigen Marktregeln experimentieren, um bessere ökologische und soziale Ergebnisse zu befördern. Das Crowding Out wird dabei auf ein ganzes Drittel der Investitionen geschätzt. Die Investitionssumme des geplanten Green Deals kann hierdurch wiederum ins Verhältnis gesetzt werden: Er entspricht der Höhe der mobilisierten Ressourcen des Juncker-Plans auf eine Laufzeit von zehn Jahren.
Dass die Klimakrise die Menschheit vor bisher ungekannte Herausforderungen stellt, hat der Idee Schubkraft verliehen, dass das Ausprobieren und Verändern von unterschiedlichen institutionellen Designs erforderlich ist. Eine Allianz zivilgesellschaftlicher Akteure, darunter unter anderem Democracy in Europe Movement 2025, European Alternatives und die New Economics Foundation, wirbt daher für einen Green New Deal for Europe.
Dieser setzt ebenfalls auf die Mobilisierung von Investitionen über die EIB. Angestrebt wird jedoch ein deutlich höheres Volumen von 5% des BIP der EU (800 Milliarden Euro) pro Jahr. Zudem soll es eine Absicherung über die Europäische Zentralbank geben, um unter anderem sichere Anleihen für die Rentenversicherungen emittieren zu können.
Der wesentliche Unterschied zwischen den Vorschlägen liegt aber in der Art und Weise, wie über die Vergabe und Nutzung der Investitionen abgestimmt werden soll. Der alternative Green New Deal sieht die Maßgabe als ausschlaggebend an, dass mit dem Investitionsschub neue Wege der Mitbestimmung und der Förderung nachhaltiger Unternehmens- und öffentlichen Trägerstrukturen gefunden werden können. Neben einer Reihe finanzmarktpolitischer Steuerungselemente, die auch eine Des-Investition aus den fossilen und braunen Energiebereichen vorsehen, wird in Anlehnung an Roosevelts New Deal die Einrichtung einer Green Public Works vorgeschlagen. Diese öffentliche Einrichtung soll auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene gegründet werden, um Projekte für sinnvolle Investitionen auszumachen.
Mit besonderen Kreditlinien soll dann erprobt werden, wie Investitionsentscheidungen auf kommunaler Ebene ausgehandelt und die Antragsverfahren so vereinfacht werden können, dass allen Bürger*innen der Zugang möglich wird. Die kommunale, regionale und nationale Politik soll sich dazu verpflichten können, Leitlinien der demokratischen, transparenten und nachhaltigen Praxis zu unterzeichnen und umzusetzen, während eine europaweite Plattform für den Austausch von Bürger*innen und Kommunen geschaffen wird. Neben diesen neuen Formen der Entscheidungsfindung zielt der Plan darauf ab, Unternehmensformen wie etwa Genossenschaften oder public-commons partnerships sowie Unternehmen mit einer konsequenten Mitarbeiterbeteiligung zu fördern.
Inhaltlich setzt der Green New Deal for Europe hierbei Prioritäten, die sich an den Bedarfen der Menschen in ganz Europa orientieren. Der Deal soll Arbeitsplätze schaffen und garantieren, die ein gutes Auskommen ermöglichen und den Übergang zu einer regulären 4-Tage-Arbeitswoche einleiten. Die möglichen Vorteile einer solchen Arbeitszeitverkürzung – mehr Zeit für Gemeinschaftliches und Care-Arbeit, gegebenenfalls mehr Arbeitsplätze und weniger überflüssige Produktion – sind bereits breit diskutiert und könnten im Rahmen eines solchen Deals ausprobiert werden.
Gesondert adressiert werden auch die gegenwärtigen Probleme auf dem Wohnungsmarkt, wo derzeit ein starkes Missverhältnis zwischen zu hohen Mieten, steigender Obdachlosigkeit, ungenutzten Wohnungen und Energieverschwendung existiert. Das Geld könnte für öffentliche Rückkäufe von Wohnungen genutzt werden, um Wohnen als Grundbedürfnis Stück für Stück wirklich sicherzustellen. Der dritte Bereich betrifft Schienen, Straßen, Netze und öffentliche Gebäude, wo unter anderem umweltfreundlichere Mobilität für alle kostenlos oder preisgünstig geschaffen werden muss, damit der Umstieg auf diese Verkehrsmittel leichter fällt.
Als Alternative zum Energiebinnenmarkt bringt der Green New Deal for Europe die Einrichtung einer Umweltunion ins Spiel. Dieser Rahmen soll das vordergründige Wettbewerbsparadigma ablösen, welches aktuell vorteilig für große Konzerne ist, und vermehrt regionale Wirtschaftsstrukturen fördern. Dies gilt sowohl für den Bereich der Energiegewinnung als auch für die Agrarwirtschaft. Der Deal schlägt vor, durch die Erklärung des Klima- und Umweltnotstands die bestehenden und sich in Arbeit befindlichen europäischen Gesetze auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. Anstelle eines Emissionshandels, der aktuell auf der europäischen Ebene geringe Erfolge erzielt, soll eine Malus- und Bonusregelung in einer ersten Testschleife auf bessere Wirksamkeit überprüft werden. Finanzmarktpolitische Steuerungen, wie sie etwa Claudia Kemfert vorschlägt, sollen ebenfalls zum Einsatz kommen. Zuletzt soll eine zivilgesellschaftlich breit besetzte Kommission für Umweltgerechtigkeit die Umsetzung des Deals überprüfen.
Resümee
Eine Binsenweisheit besagt, dass man nicht auf die gleiche Art und Weise aus einer Krise herauskommt, wie man in sie hinein geraten ist. Die Art und Weise, wie man aktuell politisch auf die Forderungen der Klimabewegungen reagiert, scheint jedoch der Versuch zu sein, mit den gleichen, alten Rezepten den berechtigten Unmut der Bürger*innen zu besänftigen. So läuft auch der Green Deal der neuen EU-Kommission Gefahr, die soziale Komponente zu vernachlässigen.
Einen Green New Deal in einem Umfeld auszurufen, in dem Manche die Forderung nach mehr Demokratie für den Ausschluss bestimmter Gruppen nutzen, bedeutet auch, Formen demokratischer Mitbestimmung und Grundrechte zu stärken anstatt diese abzubauen (z.B. durch Polizeigesetze, Verstoße gegen das Seenotrettungsgebot, Ausweisung Asylberechtigter oder Beibehaltung und bestimmte Auslegung der Abtreibungsparagraphen).
In Bezug auf den Green New Deal for Europe, wie ihn die obigen Initiativen vorschlagen, bedeutet dies, dass das aktuelle Möglichkeitsfenster – so klein es auch sein mag – konsequent für die Bestimmung demokratischer und wirtschaftlicher Formen genutzt werden muss. Denn ein dauerhaftes Makromanagement, das die Natur zwar preislich abbilden kann, dessen Richtungsbestimmung aber privatisiert bleibt, wird voraussichtlich weder das Klima noch die aktuelle unfertige Demokratie retten. Dieser politischen Rahmung sollten sich gerade auch Ökonom*innen bewusst werden.
Zur Autorin:
Janina Urban ist wissenschaftliche Referentin am interdisziplinären Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung (FGW) im Themenbereich „Neues ökonomisches Denken“. Auf Twitter: @JaninaUrban
Wir bieten eine Plattform für Artikel und Themen, die in der Mainstream-Ökonomik vernachlässigt werden. Dafür sind wir auf Deine Unterstützung angewiesen.