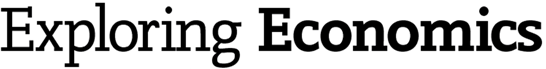Die Gespenster der Moralphilosophie
Netzwerk Plurale Ökonomik
Ein neues Traktat von Papst Franziskus löst in marktliberalen Kreisen Furore aus. Die heftige Gegenkritik wirft die Frage nach der Beziehung zwischen der Theologie und der Ökonomik auf: Wieso fühlen sich Ökonom*innen überhaupt herausgefordert? Unsere Spurensuche führt zu den theologischen Anleihen im ökonomischen Denken – die Ethik der unsichtbaren Hand.


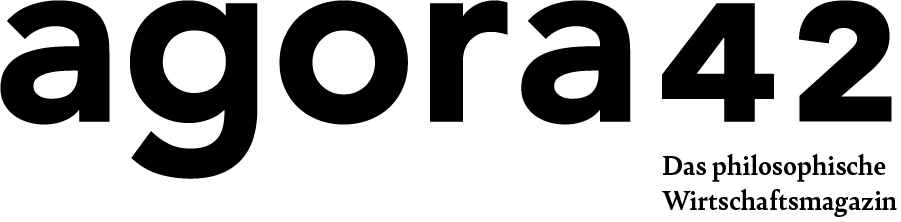
Dieser Artikel wurde auf Agora42 erstveröffentlicht.
In der Kolumne Jenseits von Angebot und Nachfrage nehmen Autor*innen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik die fachlichen Scheuklappen der Lehrbuchökonomie ab und werfen einen pluralökonomischen Blick auf gesellschaftspolitische Fragestellungen.
Anfang Oktober veröffentlichte Papst Franziskus die Enzyklika »Fratelli Tutti«, eine Art kirchliches Lehrschreiben. Er nimmt darin zu Fragen des christlichen Glaubens und zur Soziallehre in Zeiten der Pandemie sowie zur Klimakrise Stellung. Er richtet sich aber nicht nur an Katholik*innen, sondern an »alle Menschen guten Willens«. Ein lesenswerter Text: ein Aufruf zu mehr Solidarität, Liebe und Kooperation und eine Abrechnung mit der internationalen Politik.
Seine Thesen zur Wirtschaftspolitik treffen im neoliberalen Lager auf Widerstand, womit sich ein Muster fortsetzt, das unter seinem Vorgänger Papst Johannes Paul II. begann. Franziskus sei ein »Papst auf Abwegen« (Agenda Austria), der »anti-marktwirtschaftliche Ideologie und Fehleinschätzungen über Globalisierung« verbreite (Clemens Fuest). Daher müssten eigentlich »all jene die Kirche verlassen, denen aus Motiven der Barmherzigkeit am Wohlstand aller Menschen gelegen ist« (Rainer Hank, FAZ).
Diese Debatte kann befremdlich, fast abwegig klingen. Besteht denn eine Diskussionsgrundlage zwischen christlicher Theologie und politischer Ökonomie? Auf der einen Seite wird im »Geist des Evangeliums« argumentiert, auf der anderen Seite mit technischen Konzepten und Begriffen analytisch gearbeitet. Aber hier sollten wir vorsichtig sein, denn der Ursprung der modernen Wirtschaftswissenschaft in der Moralphilosophie der Aufklärung wirft einen langen Schatten. Nicht ohne Grund wird zum Beispiel die ökonomische Ideengeschichte oft als Dogmengeschichte und die innerdisziplinäre Lagerbildung als Diskurs zwischen Orthodoxie und Heterodoxie bezeichnet.
Aber wie kann man diese Krypto-Theologie genauer untersuchen, historisch verfolgen und sie hinsichtlich ihrer Relevanz einschätzen? Im Folgenden möchte ich zwei zentrale kulturwissenschaftliche Thesen vorstellen, die aus sogenannten Diskursanalysen hervorgegangen sind. Ein Diskurs in diesem Sinne wird verstanden als eine Formation von Aussagen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt das verfügbare Wissen über einen Gegenstand strukturieren und dabei festlegen, was als wahr gilt. Einer wachsenden Literatur zum Thema folgend gibt es wichtige theologische Anleihen und Parallelen im politisch-ökonomischen Diskurs, der sowohl wirtschaftswissenschaftliche Konzepte, als auch reale politische Rhetorik und institutionelle Regeln umfasst.
Die „Oikodizee“ und „ökonomische Theologie“
»Wie einen Gott sich denken, der, die Güte selbst,
den Kindern, die er liebt, die Gaben spendet,
und doch mit vollen Händen Übel auf sie gießt.«
Voltaire
Die christliche Theodizee behandelt die Frage, wie Gott es in seiner Güte und Allmacht zulassen kann, dass es ungerechtfertigtes Leiden und offenkundig Böses auf der Welt gibt. Angesichts von Naturkatastrophen und Kriegen zweifelt Voltaire an seinem Glauben. In Candide oder der Optimismus (1759) spottet er über diejenigen, die wie seine optimistische Romanfigur Pangloss davon ausgehen, dass wir schon in der »besten aller möglichen Welten« leben und sich trotz aller Krisen alles schon zum Guten wenden werde.
Die klassische politische Ökonomie, die bei Adam Smith und Thomas Malthus beginnt, formuliert ihre Wirtschaftslehre laut der oben genannten Thesen als »Oikodizee« (Joseph Vogl) beziehungsweise als »ökonomische Theologie« (Giorgio Agamben, Tim Christiaens). Damit fällt sie nicht aus dem generellen Rahmen der wissenschaftlichen Revolution, in der neue Entdeckungen und Naturgesetze oft als ein Beweis göttlicher Allmacht gedeutet wurden. Zum Beispiel heißt eines der ersten Werke der Demographie Die Göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts (Johann Peter Süssmilch, 1741).
Smith und seinen Zeitgenossen galt das Markt- und Preissystem als Realisierung des natürlich gegebenen Drangs des Menschen, seine eigenen Interessen zu verfolgen und Tauschhandel zu betreiben. Mehr noch: Gerade durch diese Eigensinnigkeit kann der Mensch besser zum Gemeinwohl beitragen, als wenn er es bewusst versuchen würde. Die unsichtbare Hand des Marktes verwandelt die verstreuten, einzelnen Interessen in ein harmonisches, selbstregulierendes Gefüge und in öffentlichen Wohlstand. Darin sollen wir nicht nur ein Wunder, sondern auch ein soziales Naturgesetz erkennen. Diese berühmte Metapher ist der Hand des Lenkers (manus gubernatoris) der Scholastik[1] entlehnt, die alles Erschaffene beseelt und lenkt und hier die gottgewollte Vorsehung der Naturordnung (oeconomia naturae) bezeichnet.
Aber es gibt auch eine düstere Seite. Es kann vorkommen, so Smith, dass Arbeiter*innen zeitweise Hunger leiden und sogar sterben. Im Namen des Marktes und des künftigen Wohlstands der Nationen (eine alttestamentarische Referenz aus dem Buch Jesaja) müssen auch notwendige Opfer gebracht werden. Malthus, ein anglikanischer Pfarrer, ist noch pessimistischer und sieht den Menschen in einem harten Kampf ums Überleben. Ihm zufolge ist die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit ungleich größer als seine Fähigkeit, genug Nahrungsmittel für alle zu produzieren, was zu Hungersnöten führen müsse. Das nennt er das Bevölkerungsgesetz. Den Armen soll dabei möglichst wenig Hilfe zukommen, denn Abhängigkeit führt zur weiteren Vermehrung und ins moralische Verderben. Nur durch harte Arbeit und einen frommen, asketischen Charakter kann man sich in Gottes Augen verdient machen.
Der lange christliche Schatten
Jetzt stellt sich aber die Frage, wieviel dieser in der Gründungsstunde der klassischen Ökonomie angelegten Theologie heutzutage noch vorhanden ist. Diese ist oft schwer auszumachen, weil sie nicht explizit diskutiert wird, sondern sich in der argumentativen Struktur eingenistet hat, die erst in einer historisch-vergleichenden Analyse offengelegt werden kann. Manchmal aber knüpfen Ökonom*innen, vor allem in den USA, die Verbindungen selbst. Zum Beispiel verstanden sich Milton Friedman und George Stigler von der University of Chicago – zwei Gründerväter des Neoliberalismus – als »Prediger« der Segnungen des Marktes und der Gefahren von staatlichen Interventionen.
Die unsichtbare Hand entfaltet sich im Neoliberalismus als Prinzip des Wettbewerbs. Dieser Wettbewerb gedeiht, so Friedrich Hayek, nur unter der Planung und Aufsicht der sichtbaren Hand des Staates. Damit einher geht eine Wende von der klassisch-naturalistischen Doktrin des »laissez-faire« zu der Erkenntnis, dass der Staat essentiell ist, um ein kompetitives Milieu, einen sicheren Rahmen einzurichten. Der Wettbewerb übernimmt in Verbindung mit dem Preissystem hier in seiner säkularen Formulierung aber genau die gleiche Funktion, die früher der theologisch aufgeladene Markt innehatte: er stellt eine hinreichende Bedingung für eine allseits vorteilhafte soziale Koordination und Selektion dar, stellt der Philosoph Tim Christiaens fest.
Die Kehrseite des Wettbewerbs sind die hohen Anforderungen an Individuen, sich als »Unternehmer ihrer Selbst« (Ulrich Bröckling) zu verstehen und zu verhalten haben. Investitionen in ihr »Humankapital« sind unerlässlich, um in der Konkurrenz zu bestehen. Sie haben die Pflicht, die Autorität der Marktsignale anzuerkennen und stets flexibel und mobil auf sie zu reagieren. Dabei tragen sie das volle ökonomische Risiko für ihr Verhalten, bis hin zur Arbeitslosigkeit. Ist in der heutigen Selbstoptimierung für die Karriere auch eine Marktgläubigkeit zu erkennen?
Joseph Vogl weist darauf hin, dass die Systemhaftigkeit und die harmonischen, ausgleichenden Tendenzen, die Smith im Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage erkennen will, in Form von Gleichgewichtsannahmen oder Effizienzmarkthypothesen im heutigen wirtschaftswissenschaftlichen Diskurs weiter Bestand haben. Die »Mechanik der Interessen« muss per definitionem zum Ausgleich führen. Widerspruch oder Zweifel daran wurden lange Zeit beiseite gewischt – einer Glaubensfrage nicht unähnlich.
Das malthusische Bevölkerungsgesetz kehrt regelmäßig in abgewandelter Form als Überbevölkerungsdiskurs zurück, also der Idee, dass zu viele Menschen auf der Welt leben, um alle adäquat zu ernähren, unter- und in Arbeit zu bringen. So werden leicht Katastrophenszenarien herbeifantasiert, die damit enden, dass ein Teil der Menschheit schlicht geopfert werden müsse – die bestehende Ungleichverteilung von Ressourcen wird hingegen meistens nicht infrage gestellt. Das ist praktisch für diejenigen, die bereits die Kontrolle über jene Ressourcen ausüben.
Fazit
Dieser kurze und selektive Exkurs in die ökonomische Ideen- und Kulturgeschichte soll verdeutlichen, dass positive Analyse und normative Urteile im Kanon des ökonomischen Wissens nicht so leicht voneinander zu trennen sind. Häufig bleibt unbeachtet, wie theologisch-moralische Argumente in die heute oft als säkular und rein technisch wahrgenommene politische Ökonomik Einzug hielten, die der Marktwirtschaft nicht nur harmonische Tendenzen attestierten, sondern ihr auch eine Heils-Mission und die legitimatorische Funktion einer höchsten Autorität übertrugen. Viele dieser Argumente kehren in Rechtfertigungen oder besser gesagt Apologien des umfassenden Wettbewerbs wieder.
Das wirksamste Mittel gegen diese Krypto-Theologie ist eine offene Diskussion über den Ursprung und die Sinnhaftigkeit häufig getroffener Annahmen anzustoßen. Dabei sollte auch auf die ethischen und politischen Implikationen der Theorien und Methoden eingegangen werden. Das spiegelt sich in den Forderungen des Netzwerks Plurale Ökonomik e.V. nach mehr Pflichtkursen im Wirtschaftswissenschafts-Bachelor in Wissenschaftstheorie, ökonomischer Ideengeschichte und Wirtschaftsethik. Solche Kurse würden die Fähigkeit der Studierenden stärken, die Inhalte kritisch zu reflektieren und später sorgsam anzuwenden. Das wäre nicht zuletzt auch ein Beitrag zu ihrer politischen Bildung.

Max Hauser studiert Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin, arbeitet als studentische Hilfskraft am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist seit 2018 im Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. organisiert. Darüber hinaus interessiert er sich für die sozial-ökologische Transformation in Theorie und Praxis.
Vom Autor empfohlen:
| SACH-FACHBUCH | ROMAN | FILME | ||
|---|---|---|---|---|
| Joseph Vogl: Das Gespenst des Kapitals (Diogenes Verlag, 2011) Giorgios Kallis: Why Malthus Was Wrong and Why Environmentalists Should Care (Stanford University Press, 2019) |
John Steinbeck: The Grapes of Wrath (1939) | Being There von Hal Ashby (1979) The Age Of Uncertainty von John Kenneth Galbraith (Doku-Serie, 1977) |
[1] Scholastik (von altgriechisch scholastikós: »seine Muße den Wissenschaften widmend«; latinisiert scholasticus: »schulisch«, »zum Studium gehörig«, auch »Student«) meint im engeren Sinne eine Epoche der Philosophie- und Theologiegeschichte zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert. Vermittelt durch muslimische Philosophen wie Avicenna (Ibn Sina) und Averroes (Ibn Ruschd) gewann innerhalb des lateinischen Gelehrtenbetriebs eine an Aristoteles orientierte Richtung an Bedeutung. Die scholastische Methode wurde vorherrschend: Ausgehend von Autoritäten wie Aristoteles oder den Kirchenvätern wurden nicht nur theologische, sondern auch naturwissenschaftliche und andere Fragen diskutiert, um zu eindeutigen Schlussfolgerungen zu kommen. Zu den wichtigsten Vertretern gehören Albertus Magnus (um 1200-1280) und Thomas von Aquin (um 1225-1275).