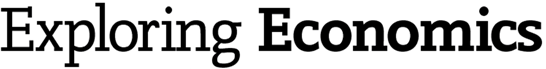Die Alltagsökonomie für ein gutes Leben
Economist for Future, 2020
Die Alltagsökonomie für ein gutes Leben
R. Bärnthaler. A. Novy und A. Strickner
Erstveröffentlichung im Makronom
Die Covid-19 Pandemie hat sichtbar gemacht, dass manche wirtschaftliche Tätigkeiten wichtiger sind als andere. Und sie hat auch die Grenzen einer marktradikalen Wirtschaftsordnung aufgezeigt: Leistungen „für alle“ durch ein öffentliches Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen, hat Vorzüge gegenüber Ansätzen, bei denen die Befriedigung von Grundbedürfnissen primär von der Zahlungsfähigkeit von Marktsubjekten abhängt.



![]()
Was folgt aus der Klimakrise für unsere Wirtschaft(sweisen) und das Denken darüber? Im Angesicht der Fridays-for-Future-Proteste hat sich aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik eine neue Initiative herausgebildet: Economists for Future. Mit der gleichnamigen Debattenreihe werden zentrale Fragen einer zukunftsfähigen Wirtschaft in den Fokus gerückt. Im Zentrum stehen nicht nur kritische Auseinandersetzungen mit dem Status Quo der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch mögliche Wege und angemessene Antworten auf die dringlichen Herausforderungen und Notwendigkeiten. Dabei werden verschiedene Orientierungspunkte für einen tiefgreifenden Strukturwandel diskutiert.
Damit eröffnete die Pandemie in kurzer Zeit einen neuen Blick auf Wirtschaft, Arbeit und Leistung. Es wäre daher ein großer Fehler – wie dies nach der großen Finanzkrise 2008 geschah – zu „business as usual“ zurückzukehren. Damit würde die Gelegenheit verpasst, aus dem Wirtschaften in der Pandemie für zukunftsfähiges Wirtschaften nach der Pandemie zu lernen. Gefragt ist zweierlei: Erstens ein gutes Verständnis des Markliberalismus, der das ideologische Unterfutter für Strategien der Liberalisierung, Privatisierung und Finanzialisierung liefert. Und zweitens die Vision einer anderen Wirtschaftsordnung sowie Strategien, um auf zukünftige Krisen effektiv und sozial-gerecht reagieren zu können. Dies kann gelingen durch die Stärkung der sogenannten Alltagsökonomie, die weite Teile der binnenwirtschaftlichen Daseinsvorsorge und Nahversorgung umfasst.
Der Marktliberalismus: die neoliberale Verengung von Wirtschaft
Der Siegeszug des Neoliberalismus seit den 1980er Jahren läutete einen Paradigmenwechsel ein, der Denk- und Handlungsweisen in zumindest drei Bereichen radikal veränderte:
1. Die Außenorientierung überlagerte den Fokus bzw. die Ausrichtung auf die Binnenwirtschaft. Damit ging die Schaffung und Liberalisierung von Märkten – inklusive diverser Märkte für die Grundversorgung – einher. Die Schaffung attraktiver Bedingungen für internationales Kapital sowie Effizienz, Optimierung und Renditeerwartungen wurden zu Leitprinzipien.
2. Eine marktwirtschaftliche Wirtschaftsverfassung verdrängte eine gemischtwirtschaftliche. Dadurch wurde Wirtschaften auf (globales) Marktwirtschaften reduziert.
3. Gesamtgesellschaftliche Zielsetzungen wurden durch individualisierte Wünsche und Präferenzen ersetzt, Gemeinwohl durch Eigennutz. Folgerichtig wurden ehemals staatsbürgerliche Rechte, von Gesundheitsversorgung und Pflege über Bildung und Wohnen, zu marktfähigen Waren und Dienstleistungen. Diese werden demnach privatwirtschaftlich produziert und von individuelle/n Konsument*innen am Markt erworben. Eigenverantwortung bedeute, sich von kollektiven Sicherungssystemen zu emanzipieren, zum Beispiel durch private Vorsorgekassen und Krankenversicherungen, Wohnungseigentum oder Investitionen in das eigene „Humankapital“.
Dieses verengte Verständnis von Wirtschaft ist heute nicht nur in den Wirtschaftswissenschaften weit verbreitet, sondern trat seinen Siegeszug in immer neuen Feldern menschlichen Zusammenlebens an. Konsequent zu Ende gedacht und illustriert haben dies insbesondere Garry S. Becker und Guity Nashat Becker in ihrem 1996 erschienenen Buch zur Ökonomik des Alltags (The Economics of Life).
Doch untergräbt die einseitige Betonung des individuellen Optimierens den sozialen Zusammenhalt, Solidarität und Resilienz. Einsparungsmöglichkeiten z. B. im Gesundheitswesen zu identifizieren, ist sinnvoll. Doch gerade im Bereich der Grundversorgung kann ein unausgewogener Fokus auf Effizienz zutiefst problematische Folgen haben, wenn Unvorhergesehenes eintritt. So revidierte zu Beginn der Covid-19-Pandemie auch der österreichische Rechnungshof seine jahrelange Forderung, „ineffiziente“ Überkapazitäten an Akutbetten abzubauen.
Dass es der „Wirtschaft“ gut geht, sagt wenig darüber aus, ob es allen gut geht
Covid-19 zeigt, dass der Markt manches, aber nicht alles lösen kann, dass Wirtschaften mehr als Marktwirtschaften ist, dass soziale Absicherung nicht nur aus der Perspektive der einzelwirtschaftlichen Effizienz betrachtet werden darf und dass eine starre Außenorientierung den innergesellschaftlichen Zusammenhalt untergraben kann. Wirtschaften ist die Organisierung und die Sicherung der Lebensgrundlagen. Zukunftsfähiges Wirtschaften stabilisiert ein solidarisches Gemeinwesen, gewährleistet die freie Entfaltung seiner Mitglieder und sichert natürliche Ressourcen und Ökosysteme. Optimierung ist fraglos hilfreich, sofern sie diesen Zielen dient.
Um dies sicherzustellen und mit dem Unerwarteten umgehen zu können, sind – entgegen einer „just-in-time“-Philosophie – Reservekapazitäten, Puffer und Redundanzen unerlässlich. Es braucht daher dringend ein anderes, umfassenderes Verständnis von Wirtschaft. Denn, dass es der „Wirtschaft“ – verstanden als Unternehmen, die am globalen Markt agieren – gut geht (gemessen u. a. an Wachstumsraten und steigendem Welthandel), sagt wenig darüber aus, ob es allen gut geht. Und es sagt auch wenig darüber aus, ob Gesellschaften krisenfest, geschweige denn zukunftsfähig sind und das Klima auf diesem Planeten weiterhin lebensermöglichend bleibt.
Bleibe auf dem Laufenden!
Abboniere unsere Newsletter, um von neuen Debatten und Theorien, Konferenzen und Schreibwerkstätten zu erfahren.
Exploring Economics Plurale Ökonomik
Die Fundamentalökonomie sichert das Überleben
Wirtschaft ist also nicht gleich Wirtschaft. Während viele Wirtschaftsbereiche in der Covid-19-Krise einem Shutdown unterzogen wurden, galt dies nicht für als „systemrelevant“ eingestufte Bereiche. Diese Fundamentalökonomie, als grundlegender Teil der Alltagsökonomie, ist der Bereich der Wirtschaft, der die Sicherung der Lebensgrundlagen garantiert und so menschliches Überleben ermöglicht. Ohne Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung, Strom, Wasser, Gas, Müllabfuhr und Wohnraum ist kein Überleben in zivilisierten Gesellschaften möglich. Die Fundamentalökonomie umfasst also, vereinfacht gesprochen, die Aktivitäten, die immer und daher auch in Krisenzeiten tagtäglich gebraucht werden. Hierzu gehören die kollektive Grundversorgung, sprich die wirtschaftlichen Aktivitäten des Sorgens – füreinander und miteinander.
Statt einer Rückkehr zum individuellen Konsumniveau vor der Krise braucht es die verbesserte kollektive Bereitstellung einer sozialökologischen Infrastruktur
Schon im März 2020 verfasste das Foundational Economy Collective, ein Zusammenschluss europäischer Wissenschafter*innen, ein Manifest für die Zeit nach der Pandemie. Aufbauend auf Forschungsarbeiten der letzten Jahre argumentiert das Kollektiv darin für eine Erneuerung und Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Fundamente und konkretisierte diese Agenda mit einem Zehn-Punkte-Programm. Dieses umfasst unter anderem eine Stärkung der öffentlichen Gesundheitsversorgung und Pflege (inkl. der Prävention), eine Reform zur Erhöhung der Progressivität im Steuersystem oder die Beteiligung der Bevölkerung bei der Gestaltung der Grundversorgung.
Im Kern betont das Manifest eine zentrale sozialökologische Forderung: Statt einer Rückkehr zum individuellen Konsumniveau vor der Krise braucht es die verbesserte kollektive Bereitstellung einer sozialökologischen Infrastruktur. Statt um Wiederaufbau gehe es um den Umbau der krisenanfälligen Vor-Corona-Ökonomie hin zu zukunftsfähigem Wirtschaften. Nur dies sorgt vor, um mit neuen Krisen besser umgehen zu können.
Die Bereitstellung essenzieller Güter und Dienste der Fundamentalökonomie kann nämlich nur eingeschränkt als Markt organisiert werden. Besonders problematisch ist gegenwärtig, dass sich im Bereich der Grundversorgung im Gefolge von Privatisierung und Liberalisierung Geschäftsmodelle etablierten, in denen private Unternehmen die öffentliche Finanzierung zur kurzfristigen Gewinnmaximierung nutzen, ohne langfristig notwendige Investitionen zu tätigen.
Doch gerade die langfristige Sicherung der Grundversorgung ist von besonderer Bedeutung, denn Grundversorgung umfasst den Großteil der wirtschaftlichen Aktivitäten, die anders funktionieren als eine globale Marktwirtschaft für Waren und Dienstleistungen. Zukunftsfähiges Wirtschaften erfordert langfristiges ökonomisches Denken, Planung, Kooperation und die Orientierung wirtschaftspolitischer Entscheidungen an Kriterien wie Konsistenz, Suffizienz und Resilienz. Das sind grundlegend andere Kriterien als die aktuell vorherrschenden – allen voran kurzfristige Gewinnmaximierung und einzelwirtschaftlicher Wettbewerb. Die Fundamentalökonomie ist die Grundlage funktionierender Gesellschaften. Sie sichert das tagtägliche Überleben.
„Brot-und-Rosen“-Ökonomie für ein gutes Leben
Seit dem Verfassen des Manifests sind nun einige Monate vergangen, die weitere Einsichten für eine zukunftsfähige Ökonomie des Alltagslebens gebracht haben: In der Zeit des Lockdowns wurde nicht nur erlebbar, was es zum Überleben braucht, sondern auch, was zu einem gelungenen Leben fehlt – denn ein gutes Leben ist mehr als das reine Überleben. Die Ökonomie des Alltagslebens sichert nicht nur das Wesentliche im Rahmen der Fundamentalökonomie. Besonders mit Hilfe der feministischen Ökonomik kann der Horizont erweitert werden. Das Lied „Brot und Rosen“ der 1912 streikenden Textilarbeiterinnen bringt es mit folgenden Zeilen auf den Punkt:
„Und wenn ein Leben mehr ist, als nur Arbeit, Schweiß und Magen, woll’n wir mehr, gebt uns das Leben, doch gebt uns Rosen auch!“
Zum guten Leben braucht es also nicht nur die Sicherung der Lebensgrundlagen (Brot), sondern auch eine menschenwürdige Arbeits- und Lebensumgebung (Rosen). Eudaimonia nannten dies die alten Griechen. Und Amartya Sen und Martha Nussbaum bauten darauf eine eigene Theorie des guten Lebens auf, die Individuen befähigt, gut zu leben, indem die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden.
In der Zeit des Lockdowns wurde nicht nur erlebbar, was es zum Überleben braucht, sondern auch, was zu einem gelungenen Leben fehlt
Wenn auch nicht für das Überleben unerlässlich, sind Kultur- und Sozialeinrichtungen, Bars, Restaurants, Frisier-Salons, öffentliche Räume und Grünflächen zentral für die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse. Gleichwohl ist ihre Bestimmung schwieriger, da das gute Leben bedeutungsmäßig poröser ist als die Definition des reinen Überlebens. Sie ist kontextuell verschieden, beruht auf Werturteilen und erfordert, Bewohner*innen in diese Bewertungen einzubinden. Transdisziplinäre Methoden und innovative Formen der Beteiligung und Partizipation sind deshalb wichtig, um jene Rahmenbedingungen, Infrastrukturen und Institutionen zu identifizieren, mit denen vor Ort das gute Leben steht und fällt. Lokal und regional organisiert, produzieren sie „vor Ort“ Werte und Wohlbefinden.
Alltagsökonomie und gesellschaftliche Bewertung von Wirtschaftsbereichen
Die Festlegung dessen, was es in welcher Form für ein gutes Leben braucht, kann also nicht von oben verordnet werden – doch genauso wenig kann es an den Markt delegiert werden. Die Frage, welche Art von Wirtschaft wir wollen und welchen Zweck sie erfüllen soll (vgl. Davies 2020; Steinberger 2020), ist tief verwoben mit der Frage danach, welche Aktivitäten gesellschaftlich wertvoll, wesentlich und kritisch sind für das Überleben, den Wohlstand und das gute Leben, aber auch welche destruktiv auf diese Bestrebungen wirken.
Durch die Covid-19 Krise findet ein Umdenken statt, das die neoklassische Werttheorie ins Wanken gebracht hat. In ihrer Marktpreistheorie des Wertes, die diejenige der klassischen Ökonomik von Smith bis Marx ablöste, bestimmen individuelle Konsument*innenpräferenzen die Nachfrage und in der Folge den Preis. Demzufolge sei es (markt-)gerecht, dass ein Investmentbanker das zig-fache einer Pflegekraft verdient. Der Kauf des dritten Autos unterscheide sich nicht vom Kauf lebensnotwendiger Nahrungsmittel. Kurzum, es ist (markt-)ungerecht, moralische Unterscheidungen zwischen Notwendigkeiten, Komfortgütern und Luxusgütern zu treffen. Jede Aktivität, die individuelle Kaufkraft findet, ist produktiv und wertvoll, unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Wert oder Zerstörungswert.
Um die Ökonomie des Alltagslebens krisensicher zu machen, sind Wert-Unterscheidungen jedoch gesellschaftlich notwendig, um die Rahmenbedingungen für ein gutes Leben für alle demokratisch zu gestalten. Während der Covid-19 Krise veröffentlichten Regierungen Listen systemrelevanter Berufe, deren Arbeitnehmer*innen Anspruch auf Kindernotbetreuung haben, und machten somit Wert-Unterscheidungen. Diese Listen umfassen unter anderem Gesundheits-, Pflege- und Rettungsdienste, Landwirte, Supermarktmitarbeiter*innen, Mitarbeiter*innen in den Bereichen Wasser, Strom und Gas sowie Lehrpersonal.
Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wert von Tätigkeiten der Grundversorgung darf nicht auf ihren Tauschwert reduziert werden
Auch jenseits von Pandemien müssen öffentliche Debatten darüber geführt werden, was ein gutes Leben ausmacht, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten und Sektoren dafür entscheidend sind, wie diese für alle bereitgestellt werden können und wer diese Tätigkeiten übernimmt. Ausdruck gesellschaftlicher Wertschätzung ist es, diese Bereiche zu stärken und deren Arbeitnehmer*innen entsprechend zu entlohnen. Es ist inakzeptabel, dass jene, kurzfristig als „Leistungsträger*innen“ gefeierten, Menschen – überwiegend Frauen – den Löwenanteil für eine funktionierende Ökonomie des Alltagslebens leisten, aber gleichzeitig besonders von ungleichen Teilhabechancen, prekären Beschäftigungsverhältnissen und schlechter Bezahlung betroffen sind. Dies im Sinne der Alltagsökonomie neu zu (be)werten, sollte nach der Pandemie eigentlich selbstverständlich sein.
Fazit
Welche Lektionen haben wir während der Covid-19 Krise gelernt und wie können wir diese für eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik hin zu einem guten Leben für alle nutzen? Erforderlich ist eine Aufwertung der überwiegend binnenwirtschaftlichen Alltagsökonomie, die jene täglich lebenswichtigen Güter und Dienstleistungen produziert, welche Lebensqualität und Nachhaltigkeit gewährleisten. Die Fundamente zu erneuern und zu transformieren heißt, jene Menschen, die „den Laden am Laufen halten“ (Zitat Angela Merkel) in den Blick zu nehmen. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wert von Tätigkeiten der Grundversorgung darf nicht auf ihren Tauschwert reduziert werden. Stattdessen müssen nachhaltiges Wohlbefinden, und damit Gebrauchswerte, ins Zentrum gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse rücken.
Um diesen Wandel zu vollziehen braucht es neue und breite Allianzen: zwischen progressiven Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Bewegungen ebenso wie mit Konservativen und Liberalen, die die Bedeutung einer kollektiven Bereitstellung der Grundversorgung anerkennen. Gerade in Deutschland, der Schweiz und Österreich, wo die kommunale Erbringung zentraler Daseinsvorsorgeleistungen durch Stadtwerke, Genossenschaften oder im Rahmen von interkommunalen Partnerschaften hohe Legitimität unter den Bürger*innen genießt, gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte. Auf diese Weise könnte eine neue Balance aus wettbewerbsorientierter, auf den Weltmarkt ausgerichteter Marktökonomie und ver- und fürsorgeorientierter Alltagsökonomie entstehen. Sie würde gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, und sie würde auch erlauben, andere Krisen mit der gleichen Haltung von Verantwortungsbewusstsein, Expertise und Solidarität anzugehen: allen voran die Klimakrise.
Zu den Autor*innen:
Richard Bärnthaler ist prae-doc am Institut für Multi-Level Governance and Development an der Wirtschaftsuniversität Wien und arbeitet im Bereich der Stadtforschung zu Themen der Alltagsökonomie.
Andreas Novy ist Leiter des Institute für Multi-Level Governance and Development und Teil des Foundational Economy Collective.
Leonhard Plank arbeitet als Senior Scientist am Forschungsbereich Finanzwissenschaft und Infrastrukturpolitik im Institut für Raumplanung der TU Wien und ist Teil des Foundational Economy Collective.
Alexandra Strickner ist politische Ökonomin, zuständig für Theorie-Praxis-Dialoge am Institute for Multi-Level Governance and Development sowie Mitbegründerin von Attac Österreich.