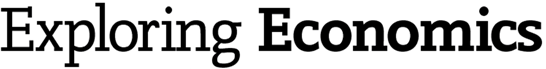Auf dem Weg zu einer existenziellen Ökonomik
Economists for Future, 2023
Auf dem Weg zu einer existenziellen Ökonomik
Manuel Schulz
Erstveröffentlichung im Makronom
Wo fängt ein Subjekt an – und wo hört es auf? Diese Frage ist zentral für die Art und Weise, wie wir über Wirtschaft nachdenken und sie organisieren. Ein Beitrag von Manuel Schulz.



![]()
Unsere Gesellschaft befindet sich inmitten eines tiefgreifenden Transformationsprozesses. Im Zentrum: die Wirtschaft. Die nächsten Jahre werden entscheiden, ob uns der Wandel by disaster passiert oder uns by design gelingt. Die Debattenreihe Economists for Future widmet sich den damit verbundenen ökonomischen Herausforderungen. Sie beleuchten einerseits kritisch-konstruktiv Engführungen in den Wirtschaftswissenschaften sowie Leerstellen der aktuellen Wirtschaftspolitik. Andererseits diskutieren wir Orientierungspunkte für eine zukunftsfähige Wirtschaft und setzen Impulse für eine plurale Ökonomik, in der sich angemessen mit sozial-ökologischen Notwendigkeiten auseinandergesetzt wird.
Wo fängt ein Subjekt eigentlich an und wo hört es auf? Diese Frage, die den meisten wohl etwas eigenartig und weit entfernt von ökonomischen Problemen erscheinen dürfte, ist jedoch grundlegend für die Art und Weise, wie wir über Wirtschaft nachdenken und sie infolgedessen organisieren. Beispielsweise zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die Frage nach den Grenzen des Subjektes von großer Relevanz für die Legitimitätsbemessung privater Aneignung ist. Denn dank der emanzipatorischen Errungenschaften – vor – allem der Anti-Sklaverei-Bewegung – kann ein Subjekt auch in vollends vermarktlichten Gesellschaften niemandem gehören, wohl aber alles, was ihm äußerlich ist.
Gefragt nach der räumlichen Grenze des Subjektes, auf die sich dieser Beitrag fokussieren möchte, würden wohl die meisten Menschen antworten, dass es die Haut sei, die als Innen-Außen-Grenze zwischen menschlichem Subjekt und Objektwelt fungiert. Die damit angesprochene Vorstellung vom Menschen als einem in sich geschlossenen Behälter, einem homo clausus, ist jedoch problematisch. Sie spaltet die existenziellen Gesamtzusammenhänge unseres Daseins künstlich in eine subjektive Innenwelt und eine objektive Außenwelt.
Eben jene Aufspaltung ist dabei maßgeblich für die ökonomische Dimension des Mensch-Natur- und des Mensch-Mensch-Verhältnisses, wie es im Zusammenspiel insbesondere von der feministischen politischen Ökologie hinterfragt wird (z. B. Gottschlich et al. 2022). Dabei lässt sich die Erfahrungswelt des Betroffenseins am eigenen Leib, so soll gezeigt werden, als empirischer Leitfaden für eine Kritik an der Vorstellung des in sich geschlossenen Einzelmenschen heranziehen.
Die historische Entstehung des homo clausus
In seinem 1939 erschienenen Werk „Über den Prozess der Zivilisation“ rekonstruiert Norbert Elias (1997a; 1997b) in kritischer Haltung ein für die westliche Moderne spezifisches Menschenbild, das er als homo clausus bezeichnet. Bei Letzterem handelt es sich um die Vorstellung eines in sich geschlossenen Einzelmenschen, der „in seinem Innern durch eine unsichtbare Mauer, von allem was draußen ist, auch von allen andern Menschen, abgeschlossen ist“ (Elias 1997a: 52).
Entlang umfassender historischer Untersuchungen zeigt Elias, dass diese Vorstellung eines menschlichen „Selbst im Gehäuse“ (ebd.: 57) Ausdruck historisch gewachsener Organisationsformen des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. Dieses Menschenbild entfaltete sich über mehrere Jahrhunderte hinweg und wurde nicht zuletzt durch die verschiedensten Fachdiskurse verstärkt. Hinsichtlich der Haut, die heute gemeinhin als Chiffre für die Außengrenze eines Menschenbehälters verstanden wird, weisen die Studien von Michel Foucault (1988) auf eine interessante Verschiebung hin. So veränderte sich mit dem Aufkommen der pathologischen Anatomie zum Ende des 18. Jahrhunderts das Verständnis der Haut grundsätzlich. Galt sie vormals als durchlässig, begann man sie paradoxerweise gerade durch die anatomische Praxis des Öffnens zunehmend als eine geschlossene Hülle wahrzunehmen. Sie erschien fortan als die Außengrenze eines Menschenbehälters, die das Innere des Körpers vor dem ärztlichen Blick verbirgt.
Elias stellt in diesem Zusammenhang die berechtigte Frage, inwiefern es im Sinne eines „sachgerechten Verständnisses des Menschen“ (Elias 1997a: 56) sinnvoll ist, den homo clausus unreflektiert zur Grundlage sozialwissenschaftlicher Analysen zu machen. Mit Blick auf die hier im Fokus stehenden wirtschaftstheoretischen Probleme weist er (1997a: 52) darauf hin, dass sich die Vorstellung des Einzelmenschen „im Zusammenhang mit bestimmten Arten der Interdependenzverflechtung, der gesellschaftlichen Bindungen von Menschen aneinander“ – man könnte auch sagen – mit den jeweiligen Produktionsverhältnissen herausbildet.
Das stahlharte Gehäuse des Einzelmenschen und sein ideologischer Nutzen
Entsprechend dieser Feststellung wird die Konstruktion einer scharfen Innen-Außen-Grenze des Subjektes schließlich dort ökonomisch relevant, wo es um die Frage nach legitimen Zugriffs- und Aneignungsrechten geht. Denn wenn das Wesen eines menschlichen Subjektes an der Haut seine Grenze findet, dann gehört das zur „Umwelt“ werdende Habitat, mit dem wir als Säugetiere existenziell verwachsen sind, nicht mehr dazu. In der Vorstellung des homo clausus reduziert sich der Mensch auf ein Einzelding, das, wie es Karl Marx (MEW 40: 512) einmal polemisch formulierte, „bis zum Hungertod entwirklicht“ wird.
Dies hat mindestens zwei Auswirkungen auf die Organisationsformen des Ökonomischen: Einerseits wird das menschliche Selbst seines Lebensraumes beraubt und die zum Außen gemachte Umwelt für eine ungehemmte private Aneignung verfügbar gemacht. Andererseits, und als Folge dessen, wird die Verantwortung für den Umgang mit dem so erzeugten „Mangel“ individualisiert. Im Rahmen herrschender Eigentumsverhältnisse pfercht man das Subjekt in das stahlharte Gehäuse eines Einzelmenschen ein – ein Gehäuse, aus dem nur noch die Zahlungsfähigkeit herausführt. Mittels letzterer können wir dann Ausschnitte des „Äußerlichen“ käuflich erwerben, man müsste streng genommen sagen, sie zurückkaufen.
Infolgedessen prägt die Vorstellung des homo clausus nicht nur das Mensch-Natur-Verhältnis, sondern in erheblichem Maße auch das Verhältnis der Menschen untereinander. Im Zusammenhang mit letzterem Aspekt ist hinzuzufügen, dass der Einzelmensch in der Regel als autonome erwachsene Person vorgestellt wird. Elias (1997a: 50) schreibt: „Von der Tatsache, daß [der Mensch] als Kind auf die Welt gekommen ist, von dem ganzen Prozeß seiner Entwicklung zum Erwachsenen und als Erwachsener, sieht man bei diesem Menschenbild als unwesentlich ab“. Dementsprechend gilt es bei der Kritik an der für kapitalistische Gesellschaften typischen Abwertung des Care-Sektors neben der patriarchalen Dimension (Bauhardt 2019) nicht zuletzt auch auf den entscheidenden Beitrag hinzuweisen, den der homo clausus in diesem Kontext historisch gespielt hat und bis heute spielt.
Ideologisch ist das kritisierte Menschenbild mit seiner Verleugnung existenzieller Gesamtzusammenhänge also aus mindestens zwei Gründen: Erstens steht es in einem deutlichen Widerspruch zu empirischen Tatsachen und zweitens erzeugt es spezifische Formen der Bedürftigkeit, welche fortan warenförmig erschlossen und die resultierenden Gewinne privat angeeignet werden können.
Das Spüren am eigenen Leib als empirische Grundlage der Kritik
Dabei gibt es eine Wissenschaftsdisziplin, die es uns erlaubt, den Reduktionismus dieses Menschenbildes entlang empirischer Beobachtungen aufzudecken und zu kritisieren. Es handelt sich um die Leibphänomenologie, also um die Wissenschaft von den Erscheinungsformen eigenleiblicher Erfahrung.
Ein Vertreter dieser Disziplin ist Hermann Schmitz (1928-2021), der Begründer der Neuen Phänomenologie (z. B. Schmitz 2016). Entlang der von ihm entwickelten Erkenntnistheorie wird deutlich, dass wir es beim Verhältnis von Subjekt und Umwelt keineswegs mit einer starren Innen-Außen-Grenze zu tun haben. Vielmehr sind die Grenzen zwischen dem Subjekt und den es umgebenden Gegenständen der „äußeren“ Welt fließend, was sich an einfachen Alltagsbeispielen veranschaulichen lässt; nehmen wir den geübten Umgang mit einem Werkzeug, z. B. das Fahren mit dem Fahrrad oder die Benutzung von Messer und Gabel. Blieben die Gegenstände unseres alltäglichen Umganges bloße Dinge der „äußeren“ Welt, wie es das Menschenbild des homo clausus im Einklang mit klassischen Erkenntnistheorien suggeriert, könnten wir nur sehr schwer oder gar nicht intentional mit ihnen handeln.
Im Unterschied dazu zeigt eine neophänomenologische Betrachtung, dass die Gegenstände im Falle des vertrauten Umganges mit ihnen von uns als etwas wahrgenommen werden, das dem Selbst spürbar angehört. Eine „Subjektgrenze“, wenn es sie denn überhaupt geben sollte, ist hier vorübergehend aufgehoben oder zumindest an die Ränder des praktischen Vollzuges verschoben; ein Phänomen, für das Schmitz (2016: 184) den Begriff der „Einleibung“ entwickelt hat. Dabei wird uns zumeist erst dann bewusst, was gelingende Einleibung bedeutet, wenn sie Schwierigkeiten macht, sprich, wenn wir auf oder in ein ungewohntes Fahrzeug steigen oder anstatt Messer und Gabel Essstäbchen verwenden. Dann wird die Dingwelt widerständig, so widerständig wie die kapitalistisch eingerichtete Warenwelt in dem Moment, wo man ohne Zahlungsmittel versucht, beim Supermarkt an etwas Essbares zu kommen.
Die leibphänomenologische Kritik an der Ausblendung existenzieller Gesamtzusammenhänge kann dabei nicht zuletzt auch auf den Care-Sektor angewendet werden. Auch in dieser Hinsicht lassen sich pathische, d. h. leiblich spürbare Erfahrungen aufzeigen, die die Vorstellung eines autonomen Menschenbehälters empirisch Lügen strafen. Ein anschauliches Beispiel der jüngeren Vergangenheit ist die Corona-Pandemie. Hier fanden sich die Menschen in eine Situation gestürzt, in der die am eigenen Leib erfahrene Sorge um das Nichtversorgtwerden grassierte. Dabei gewannen die Menschen einen empirischen Einblick in die existenzielle Notwendigkeit von Sorgearbeit und wurden sich spürbar gewahr, dass es mit der Autonomie eines Einzelmenschen nicht weit her ist (Schulz 2021).
Was den zahlreichen Studien über die Missstände im Care-Sektor in den Jahren zuvor nicht gelungen war, namentlich ein kollektives Problembewusstsein zu erzeugen, schaffte das Betroffensein am eigenen Leib über Nacht. Schlagartig erlangte die wechselseitige Verwiesenheit der Menschen eine pathische Evidenz, welche in einer weit verbreiteten Kritik an den herrschenden Organisationsformen der Sorgearbeit mündete.
Fazit – existenzielle Ökonomik als emanzipatorischer Prozess
Unabhängig von der historisch gewachsenen Vorstellung von in sich geschlossenen Einzelmenschen erlaubt es uns das Spüren am eigenen Leib, die Grenzen des Subjektes entlang empirischer Einsichten neu auszuloten. Auf der Ebene des Leiblichen finden wir eine Art Basiserfahrung, die als Leitfaden für die Einschätzung der Legitimität von eigentumsrechtlichen Ein- und Ausgrenzungskriterien sowie für die Frage nach der vernünftigen Organisation der Daseinsvorsorge herangezogen werden kann (insbesondere zu letzterem siehe Schulz 2020). Wir stehen den Dingen und den anderen Menschen nicht äußerlich und unverbunden gegenüber, sondern wir befinden uns mit beiden Sphären in einen existenziellen Gesamtzusammenhang pathisch verstrickt – einen Gesamtzusammenhang, an dem sich eine am Menschenbild des homo clausus orientierte Wirtschaftswissenschaft konzeptionell die Zähne ausbeißen muss.
Mit Blick auf eine Ökonomik, die sich dieser leiblich erfahrbaren Interdependenzverkettungen bewusst ist, sind insbesondere zwei Aspekte zu betonen: Einerseits ist analytisch streng nach subjektiver und individueller Erfahrung zu unterscheiden. Denn zwar sind die als Empirie heranzuziehenden Erfahrungen in höchstem Maße subjektiv, denn niemand kann meinen Hunger oder meine Sorge um das Nichtversorgtwerden empfinden. Sie besitzen eine spezifische Dimension, die die Neue Phänomenologie (Schmitz 2011: 73 ff.) als „subjektive Tatsächlichkeit“ bezeichnet. Dennoch sind sie eben offenkundig keineswegs individuell im Sinne des sozialen Status oder der gesellschaftlich-kulturellen Vermitteltheit.
Des Weiteren ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass eine entsprechend vorzunehmende Neuvermessung der Grenzen des Subjektes die Fortsetzung eines emanzipatorischen Projektes darstellt. Denn während die hier vorgeschlagene Perspektive eine subjekttheoretische Grenzverschiebung nach Außen nahelegt, war und ist es der umgekehrte Weg, sprich die Grenzverschiebung nach Innen, die charakteristisch für das ökonomische Ausbeutungsverhältnis der Sklaverei ist. Nicht ohne Grund versuchte man zu deren Hochzeiten die Entrechtung der betroffenen Menschen damit zu legitimieren, dass man ihnen die Fähigkeit zum subjektiv innenweltlichen Erleben absprach. Das Ziel dabei war es, die Grenze des legitimen Zugriffs von Außen so weit auszudehnen, bis man es vermeintlich bloß noch mit einem Gegenstand der äußeren Welt zu tun hat – eine Strategie, die im Übrigen mit Blick auf das Mensch-Tier-Verhältnis bis heute andauert.
Der dringend nötige Aushandlungsprozess über die erwähnte Grenzverschiebung birgt natürlich – und hier sollte man sich keinen Illusionen hingeben – eine kaum zu überschätzende gesellschaftspolitische Sprengkraft. Allerdings scheint dies angesichts der zunehmend verheerenden Folgeerscheinungen gegenwärtiger Grenzregime, seien sie subjekttheoretischer oder geografischer Natur, dringender denn je. In dieser Hinsicht haben die beiden derzeit wohl größten Tragödien der westlichen Gesellschaften, die sozial-ökologische Krise und der unmenschliche Umgang mit Migrationsbewegungen, eine strukturverwandte Ursache: empirisch nicht begründbare Grenzziehungen, die gleichermaßen ideologisch wie existenziell verheerend sind.
Zum Autor:
Manuel Schulz studierte Soziologie und Volkswirtschaftslehre in Marburg und wurde im Herbst 2022 am Arbeitsbereich Allgemeine und Theoretische Soziologie der Universität Jena promoviert. Seine bisherigen Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere in der Neuen Phänomenologie, in der allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie sowie in zeittheoretischen Analysen auf dem Gebiet der Finanzmarktsoziologie. Ab März 2024 wird er als Postdoc an der Universität zu Köln aller Voraussicht nach ein eigenes Forschungsprojekt zu den Grundlagen einer existenzphilosophischen Wirtschaftssoziologie durchführen.